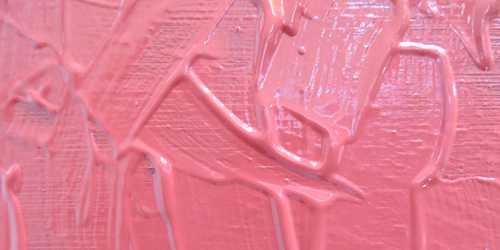Lange Zeit wurde die Wissenschaft und Forschung über Sexualität unterdrückt. Die Kulturgeschichte hilft uns nicht unbedingt beim Verständnis der Sexualität. Wie Evolutionsbiologen den Sinn des Liebeslebens erklären.
Sie bewegt uns von der Geburt bis ins hohe Alter, sie lockt uns auf Werbeplakaten, sie beschäftigt Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen, sie gehört zu den am stärksten gesetzlich reglementierten Bereichen unserer Gesellschaft, sie erregt in jeder Hinsicht unsere Gemüter, sie inspiriert Künstler seit der Steinzeit und sie steht auch im Alltag stets im Zentrum unseres Interesses und Lebens: Sexualität, die Geschlechtlichkeit des Menschen und anderer Lebewesen. Aber dennoch – oder vielleicht gerade deswegen, weil mit ihr die Essenz des Lebens verbunden ist – ist sie uns nach wie vor ein Rätsel.
 In der christlich-jüdischen Schöpfungsgeschichte erschuf Gott am sechsten Tag Adam (hebräisch: ădāmāh, Ackerboden), der zuerst nur mit anderen Tieren ohne weibliches Gegenüber die Welt bewohnte. Gott entnahm Adam eine Rippe und schuf aus dieser Eva (hebräisch: ḥawwāh, die Belebte). Adam erkennt in der Begegnung mit dem neuen Wesen in sich den Mann und in seinem Visavis eine Frau. Als die beiden verbotenerweise eine Frucht vom Baum der Erkenntnis essen, werden sie sich plötzlich ihrer Nacktheit bewusst und beginnen sich dafür zu schämen. Mit diesem in der Bibel als ‚Sündenfall' bezeichneten Akt kam die Sexualität in unsere abendländische Kultur und blieb bis heute die von zahlreichen Regeln, Traditionen und Missverständnissen geprägte ‚wichtigste Sache der Welt'.
In der christlich-jüdischen Schöpfungsgeschichte erschuf Gott am sechsten Tag Adam (hebräisch: ădāmāh, Ackerboden), der zuerst nur mit anderen Tieren ohne weibliches Gegenüber die Welt bewohnte. Gott entnahm Adam eine Rippe und schuf aus dieser Eva (hebräisch: ḥawwāh, die Belebte). Adam erkennt in der Begegnung mit dem neuen Wesen in sich den Mann und in seinem Visavis eine Frau. Als die beiden verbotenerweise eine Frucht vom Baum der Erkenntnis essen, werden sie sich plötzlich ihrer Nacktheit bewusst und beginnen sich dafür zu schämen. Mit diesem in der Bibel als ‚Sündenfall' bezeichneten Akt kam die Sexualität in unsere abendländische Kultur und blieb bis heute die von zahlreichen Regeln, Traditionen und Missverständnissen geprägte ‚wichtigste Sache der Welt'.
Trotz ihrer zentralen Bedeutung in der menschlichen Gesellschaft wurden Wissen und Forschung dazu stets unterdrückt. Der schwedische Naturforscher Carl von Linné veröffentlichte im 18. Jahrhundert die damals gleichsam neue wie skandalöse Theorie, dass auch Pflanzen Geschlechtsorgane besitzen und sich daher auf sexuelle Weise vermehrten. Dies rief zahlreiche Kritiker auf den Plan. Der Sexualkundeforscher Alfred Kinsey hat dann in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren als Erster umfassende und statistisch abgesicherte Erhebungen über das sexuelle Verhalten des Menschen durchgeführt.
Kinsey, ein Biologe, der sich zuvor zwei Jahrzehnte lang mit der Erforschung von Gallwespen beschäftigt hatte, wäre heute völlig unbekannt, wenn er nicht auf Einladung der Universität von Indiana eine Vorlesung über die Ehe (damals ein Synonym für Sexualkundeunterricht) angeboten hätte. Da er keine Literatur zur Biologie menschlicher Sexualität fand, begann er selbst Daten zu erheben, anfangs unter den Studenten, später auch in den Nachbarstädten und schließlich in den ganzen USA. Seine Methoden waren rein an wissenschaftlichen Kriterien ausgerichtet, die Zahlen statistisch abgesichert. Die wesentlichste und spektakulärste Erkenntnis seines ersten Reports ‚Sexual Behavior in the Human Male' (Das sexuelle Verhalten des Mannes, 1948) war die unerwartete Häufigkeit homosexueller Verhaltensweisen: Nach seinen Erhebungen hatten 37% der Männer im Laufe ihres Lebens zumindest einen gleichgeschlechtlichen Kontakt inklusive Orgasmus gehabt. Die Empörung über diese Publikation war groß, denn was nicht sein darf, konnte nicht sein. Neben den Konservativen attackierten auch Wissenschaftler die Arbeit: Die bekannte Anthropologin Margaret Mead meinte, diese Ergebnisse hätten nicht veröffentlicht werden dürfen, da sie den Vorsatz junger Menschen, ein konventionelles Sexualleben zu führen, moralisch untergraben würden.
1953 publizierte Kinsey seine zweite Studie über das Sexualverhalten der Frau. Auch darin zeigte sich, dass die gelebte menschliche Sexualität nicht mit den von Religion, Moral oder Gesetz vorgeschriebenen Normen übereinstimmte. Diesmal, am Höhepunkt der McCarthy-Ära, ließen sich die Wogen nicht glätten. Als er sich weigerte, seine Interviewdaten an das FBI weiterzugeben, um mit diesen homosexuelle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst aufzuspüren, wurden ihm alle Forschungsgelder wegen ‚subversiver Einübung in den Kommunismus' gestrichen. Zwei Jahre später starb Kinsey, ohne seine letzten Daten und Auswertungen veröffentlicht zu haben.
Der Blick auf unsere Kulturgeschichte hilft uns nicht unbedingt beim Verständnis der Sexualität, sondern wirft eher noch mehr Fragen auf. Nähern wir uns dem Phänomen daher aus evolutionsbiologischer Sicht. Hier stellt sich die Frage, warum es überhaupt zwei verschiedene Individuen einer Lebensform braucht, um Nachwuchs zu erzeugen. Parthenogenese, die sogenannte Jungfernzeugung, ist eine im Tierreich mögliche und durchaus verbreitete Form der eingeschlechtlichen Fortpflanzung. Viele Insektenarten, aber auch manche Schnecken-, Fisch- und Eidechsenarten können Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen heranwachsen lassen.
Sexualität erscheint aus dem Blickwinkel einer Kosten-Nutzen-Rechnung als reiner Luxus, denn sich asexuell vermehrende Lebewesen können grundsätzlich immer mehr Nachkommen hervorbringen als jene, die Zeit damit verschwenden, zuerst einen passenden Partner zu finden und mit diesem dann erfolgreich Keimzellen auszutauschen. Der wesentliche Nachteil besteht aber darin, dass die doppelte Ressource von zwei Lebewesen aufgewendet werden muss, um einen Nachkommen hervorzubringen. Da das männliche Geschlecht keine Jungen bekommen kann, gerät bei ungefähr gleicher Anzahl männlicher und weiblicher Kinder jede sich sexuell fortpflanzende Population bereits nach wenigen Generationen zahlenmäßig ins Hintertreffen.
Warum hat sich aber dennoch das Prinzip der Sexualität bei allen höher entwickelten Lebewesen auf unserer Welt durchgesetzt? Dazu wurden von Evolutionsbiologen in den letzten hundert Jahren zahlreiche Theorien entwickelt, die aber meist einer kritischen Überprüfung nicht standhalten konnten.
Der Ökologe Maynard Smith postulierte 1971, dass bei der Vermischung des Erbguts zweier Individuen deren Nachkommen durch die dabei entstehenden neuen Eigenschaften eine bessere Nutzung von Nischen und eine optimierte Anpassung an Veränderungen möglich wäre. Diese Theorie ist mit einer Lotterie vergleichbar: Asexuelle Fortpflanzung bedeutet in diesem Fall den Besitz vieler Lose mit derselben Nummer. Aber um die Gewinnchancen zu erhöhen, braucht es eher viele verschiedene Lose, wie sie durch die Paarung zweier Lebewesen entstehen. Sexualität erzeugt Vielfalt und lässt deshalb einige Nachkommen außergewöhnlich stark und andere eher kümmerlich werden, asexuelle Fortpflanzung macht sie hingegen alle durchschnittlich gleich. Demnach müsste es Sexualität vor allem bei kleinen Lebewesen in sich stark verändernden Umwelten geben, und große, langlebige Organismen, die wie der Mensch in stabilen Verhältnissen leben, sollten vor allem durch Jungfernzeugung entstehen. Wir wissen, dass die Wirklichkeit eine andere ist.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts begann sich der Blick auf die zentralen Herausforderungen für das Überleben eines Lebewesens zu ändern: Nicht so sehr Umweltfaktoren wie Dürre, Frost, Nahrungsmangel oder Konkurrenten und Räuber verkürzen das Leben, sondern Parasiten wie Einzeller, Bakterien, Pilze und Viren. So werden zum Beispiel mehr Kaninchen durch das Myxomatose-Virus getötet als durch Füchse, Jäger und strenge Winter. Was macht diese Schmarotzer so gefährlich? Sie sind kleiner, haben kürzere Lebensspannen und vermehren sich dabei deutlich schneller als ihre Wirte. Darmbakterien bringen im Lauf eines Menschenlebens sechs Mal so viele Generationen hervor, wie die ganze Menschheit benötigte, um sich von ihren äffischen Vorfahren bis heute zu entwickeln. Und hier beginnt das Wettrüsten: Die Überlebenschancen des Wirts hängen davon ab, ob sein Immunsystem die Eindringlinge abwehren kann. Je besser sich der Wirt verteidigt, desto schneller muss der Parasit neue Generationen hervorbringen, um diese Abwehr zu durchbrechen.
Sexualität macht sich jedenfalls bezahlt: Parasiten, die uns in Form von Krankheiten entgegentreten, liefern uns einen guten Grund dafür, unsere Gene in jeder Generation neu zu durchmischen. Würden wir immer nur eine Kopie von uns selbst ziehen, hätten uns die flexiblen und winzigen Angreifer längst ausgerottet. Das mag nun wie eine abstruse und verstörende Erklärung für die Vielfalt unserer menschlichen Existenz klingen. Die vielgestaltigen Höhen und Tiefen der Partnerwahl, die Kultur der Liebe, Romanzen, Dramen, Bindungen sollen lediglich Nebenerscheinungen bei dem Versuch unserer Gene sein, sich gegen Parasiten zu wehren?
Mathematische Modelle und empirische Befunde stützen diese naturwissenschaftliche Sichtweise. Doch wie schon in meinen vorausgegangenen Essays steht am Ende die humanistische Forderung, zwar seine Natur zu erkennen, sich aber auch darüber als Mensch zu erheben. Im Unterschied zu anderen Lebewesen haben wir immer die Wahl, wie wir entscheiden und unser ganzes Leben – einschließlich unserer Sexualität – gestalten.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.