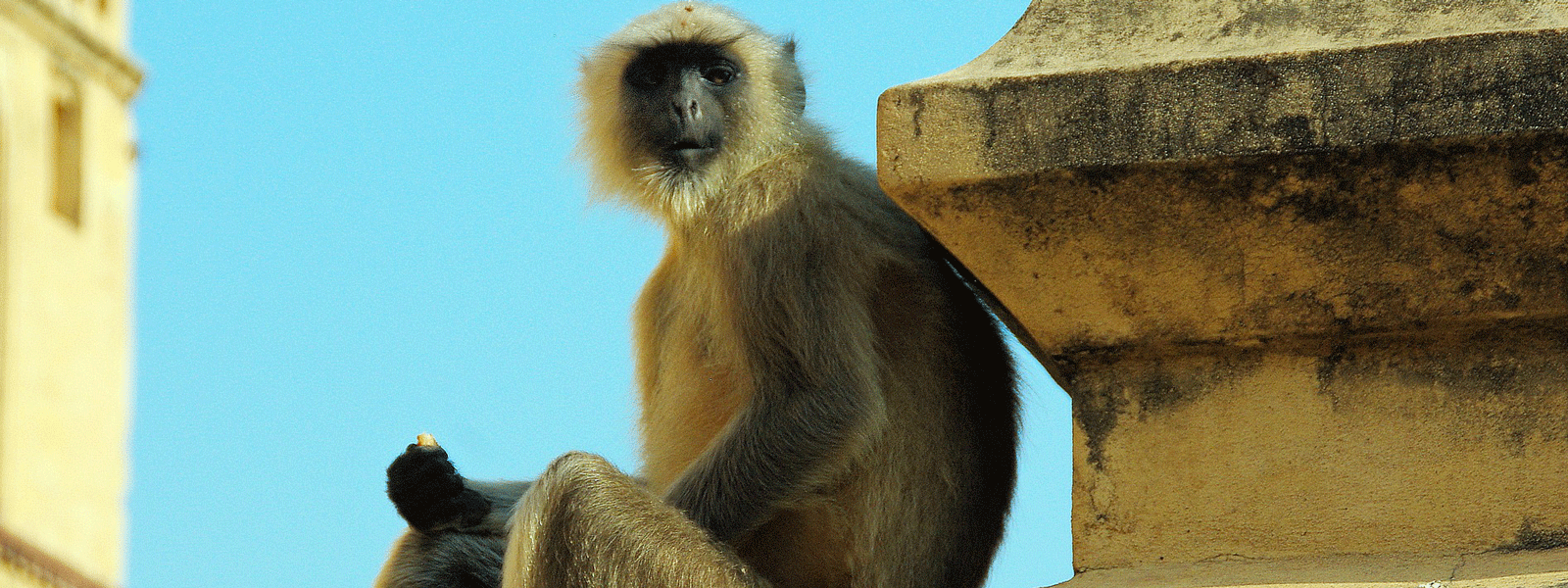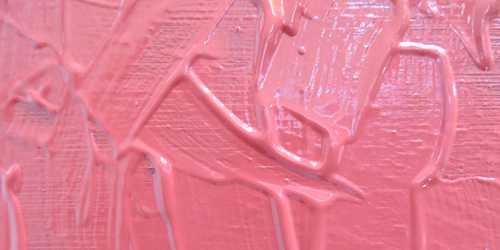Immanuel Kant, der bedeutendste europäische Philosoph im Zeitalter der Aufklärung, beschäftigte sich mit vier zentralen Fragen zu unserer Existenz: Die ersten drei – Was kann der Mensch wissen, was soll der Mensch tun, was darf der Mensch hoffen – münden in einer umfassenden vierten Frage: Was ist der Mensch?
Aus Sicht der Evolutionsbiologie kann Letzteres nur beantwortet werden, wenn wir die Antwort auf eine zusätzliche Frage finden: Woher kommt der Mensch?
In der christlich-jüdischen Entstehungsgeschichte wird der Mensch von Gott geschaffen und in seiner bestehenden und vollendeten Form – so wie alle anderen Lebewesen – in die Welt gesetzt. Die Vorstellung einer sich selbst überlassenen Entwicklung, die noch dazu nicht von einem göttlichen Plan, sondern von Zufall und Auswahl geprägt sein sollte, erschien daher lange Zeit – und mancherorts auch noch bis heute – undenkbar und häretisch.
Darwins Evolutionstheorie implizierte nicht nur, dass in ferner Vergangenheit der Mensch Tiere als Vorfahren gehabt hatte, sondern sie stellte auch infrage, dass die jetzige Form des Menschen eine gottgleiche sei und er damit die unübertreffliche Krone der Schöpfung darstelle. Wer diesen Sturz vom Thron verkraftet, wird dafür aber in der Lage sein, die Indizien zu lesen, die unsere viele Millionen Jahre dauernde Entwicklung an uns hinterlassen hat.
Unsere ältesten Säugetierahnen leben vor circa 40 Millionen Jahren und haben die Gestalt eichhörnchengroßer Ur-Nagetiere, die Baumkronen bewohnen. Jene Tiere, deren Klauen immer mehr die Form von Greifhänden annehmen und deren Augen nach vorne ins Gesicht wandern, um besser räumliche Tiefen einschätzen zu können, sind ihren Artgenossen gegenüber im Vorteil und werden mit mehr Nachkommen belohnt. Diese beiden zentralen Fähigkeiten – perspektivisches Sehen und eine hochkomplexe, bewegliche Hand – zeichnen auch heute noch jeden Handwerker, Musiker, Jäger und Sportler aus.

Unser Weg führt dann vom Baum herab ins Unterholz der schützenden Wälder, wo auch in unseren Tagen noch Schimpansen und Gorillas bevorzugt leben und eine vielfältige Kost aus Beeren, Grünpflanzen und in seltenen Fällen kleinen Tieren das Fortkommen sichert. Gerade diese Jagd auf flinke Tiere mit ihrem begehrten roten Fleisch gelingt nur im Sozialverband und legt die Grundlage für eine weitere, besondere Fähigkeit des zukünftigen Menschen: Mitgefühl und Gemeinschaftssinn.
Doch vorerst steht noch der nächste und wirklich große Schritt an, der uns auf die ungeschützten Flächen der ostafrikanischen Savanne hinausführt. Hier dominieren bissige Zebras, schnelle Antilopen, mächtige Elefanten und vor allem tödliche Raubtiere wie Löwe und Leopard. Was ist der besondere Vorteil, der auf jene Vorfahren in dieser riskanten Zone wartet? Nahrung, denn bedingt durch den Klimawandel schrumpfen die ausgedehnten Regenwälder und durch die weiten Steppengebiete ziehen – über viele Jahrtausende – große Tierherden, die von den Gletschern im Norden nach Süden gedrängt werden. Die kranken, schwachen oder frisch verendeten Tiere sind zwar eine üppige Nahrungsquelle, doch auch die Herausforderungen sind groß. Hier können nur jene erfolgreich bestehen, die im Steppengras den Überblick behalten und es durch aufrechten Gang überragen. Wer aber freie Extremitäten besitzt, die zu hoch organisierten und feinmotorischen Bewegungen fähig sind, der kann auch Steine werfen, Beute tragen und im doppelten Wortsinn die Welt begreifen. Intelligenz ist jetzt besonders wichtig: Zuerst muss man sterbende Tiere ausmachen, dann Distanzen von einigen Kilometern schnell zurücklegen, um zeitgerecht vor den stärkeren Raubtieren ans Ziel zu gelangen, den Kadaver ohne scharfe Krallen zu öffnen, sich gegen Schakale, Geier und Löwen zu erwehren und schließlich noch das Fleisch zurück zu den nicht so mobilen schwangeren Weibchen und Kindern zu bringen.
In dieser Zeit bilden sich bei jenen, die erfolgreich sind und überleben, die wesentlichen menschlichen Eigenschaften heraus: die Fähigkeit zur komplexen Kommunikation, die das gemeinschaftliche Jagen erst ermöglicht, der Gebrauch von Werkzeugen wie Waffen, um die körperlichen Defizite gegenüber den Konkurrenten auszugleichen, die sonst im Tierreich seltene Befähigung, ausdauernd laufen zu können und – vielleicht am wichtigsten – soziale Bindungsfähigkeit und Altruismus. Einzelgänger haben in dieser Umwelt keine Chance, die Sippe ist der einzige Schutz gegen die Vielzahl an Gefahren, und wer seine Beute nicht teilt, dem geben auch die anderen nichts ab.
So, vom unerbittlichen Prinzip des Erfolgs geformt, erscheint vor mehr als 1,5 Millionen Jahren in unserer Entwicklungsgeschichte ein Vorfahre, den wir als unseren Urgroßvater akzeptieren könnten: Homo erectus. Im Unterschied zu den zahlreichen anderen menschenähnlichen Lebewesen, die Ostafrika besiedelten, ist dieser Vormensch, wie der berühmte Paläoanthropologe Richard Leakey es formulierte, ‚die erste hominine Art, die das Feuer benutzte, die erste, die das Jagen als ein wesentliches Element zur Sicherung ihrer Nahrungsversorgung einsetzte und die erste, die wie ein moderner Mensch laufen konnte'. Auch sein Gehirn ist mit bis zu 1200 cm3 gegenüber den ersten Savannenbewohnern fast um das Doppelte vergrößert. Die Zähmung des Feuers ist es wiederum, die dem ‚aufrechten Menschen' das Vordringen in die kalten nördlichen Zonen ermöglicht.
Am Schluss bleiben nur mehr wir in Form des Homo sapiens übrig, Menschen mit vergleichsweise hoher Stirn, schlanker Nase und leichteren Knochen als der mit dem Ende der Eiszeiten verschwindende Neandertaler.
Auf diese Weise gleichsam in der Gegenwart angekommen, drehen wir die Blickrichtung um und schauen zurück, wie uns heute lebenden Menschen diese viele Millionen Jahre dauernde Anpassung geformt und unser Verhalten bestimmt hat. Oft geben wir der sogenannten Natur die Schuld für das, was wir an uns nicht mögen, anstatt zu würdigen, was wir ihr verdanken. Im Hollywood-Film ‚African Queen' bringt Katharine Hepburn diese Sichtweise auf den Punkt: „Nature, Mr. Allnut, is what we are put in this world to rise above." – „Die Natur, Mister Allnut, ist das, worüber wir uns in dieser Welt erheben sollten."
Das mag im Licht der bisherigen Ausführungen paradox erscheinen, denn erst durch unsere Naturgeschichte sind wir zu dem geworden, was uns auszeichnet.
Immer wieder wurde und wird versucht, jene Merkmale darzustellen, die uns Menschen vom Rest der Lebewesen auf dieser Erde unterscheiden. Die Liste der vermeintlich exklusiven menschlichen Fähigkeiten ist lang, doch nur weniges davon hat einer genauen Überprüfung standgehalten.
Lange Zeit hat man den Gebrauch von Werkzeugen bei Tieren nicht erkannt oder erkennen wollen. Wolfgang Köhler, der Begründer der Gestaltpsychologie, publizierte erstmals in den 1920er Jahren seine Beobachtungen an Schimpansen, die Stöcke ineinander steckten, um so an Futter, das weit außerhalb ihres Käfigs lag, zu gelangen. Die Primatenforscherin Jane Goodall wiederum beschrieb, wie Schimpansen Blätter als Ersatz für einen Schwamm verwenden, um mit ihrer Hilfe Wasser aus Baumlöchern aufzutunken. In einem ihrer Filmdokumente sieht man sogar, wie sich ein Schimpanse, der an Durchfall erkrankt ist, mit Blättern säubert.
Nach und nach entdeckten Forscher in weiteren Tiergruppen den gezielten Einsatz von Arbeitsgeräten. Seeotter legen sich, auf dem Rücken treibend, Steine auf den Bauch und benutzen sie zum Knacken von Schalentieren, Rabenvögel verbiegen dünne Drähte, um damit Futter zu angeln und Elefanten werfen Steine gegen Elektrozäune, um diese gefahrlos umzulegen.
Dann sprach man Tieren Emotionen ab und sah sie nur als Reiz-Reaktions-Maschinen, bis die Verhaltensforschung zutiefst menschliche Gefühle wie Trauer, Angst und sogar Aberglauben bei Vögeln und höheren Säugetieren dokumentierte.
Auch ‚negative' Eigenschaften des Menschen wie die Fähigkeit zur Täuschung oder sogar gezielter Mord konnte bei Vögeln und Primaten nachgewiesen werden.
Hat der Mensch dann überhaupt Alleinstellungs-Merkmale?
Durchaus, wobei manche völlig bedeutungslos erscheinen, wie zum Beispiel unser Haupthaar, das im Unterschied zu allen anderen behaarten Säugetieren über einige Jahre hinweg kontinuierlich wachsen kann und beachtliche Längen erreicht.
Doch das hervorragendste Merkmal findet sich in der Evolution unseres Sexualverhaltens. Im Unterschied zu sämtlichen anderen Tierarten – mit Ausnahme der uns nächstverwandten Schimpansen und Bonobos – üben Menschen Sexualität nicht nur zu bestimmten, genetisch fixierten Fortpflanzungszeiten aus, sondern verkehren sexuell mit ihren Partnern selbstbestimmt das ganze Jahr über. Ein dabei essenzieller Unterschied zu anderen Lebewesen ist, dass menschliche Frauen grundsätzlich ganzjährig empfängnisbereit sind, der genaue Zeitpunkt ihres Eisprungs aber weder durch körperliche Signale (z.B. Schwellung oder Färbung des Genitalbereichs) noch durch geändertes Verhalten (wie etwa die ‚Rolligkeit' bei Katzen) ohne medizinische Diagnostik erkennbar ist.
Diese Phase der weiblichen Fruchtbarkeit sichtbar zu machen ist zumindest im Tierreich ein sehr sinnvoller Hinweis, der das oft aufwendige und kräftezehrende Balzverhalten auf kurze Zeitabschnitte im Jahr reduziert. Wenn dieses wichtige Erkennungszeichen für beide Geschlechter der Menschen wegfällt (selbst Frauen kennen den exakten Zeitpunkt ihres Östrus nicht), dann stellen Evolutionsbiologen zu Recht die Frage, welcher Vorteil mit der Verschleierung des Eisprungs erreicht wird.
Die Theorien dazu werden von Wissenschaftlern zum Teil heftig und kontrovers diskutiert.
Eine Reihe von Autoren vertritt die Position, dass der versteckte Eisprung, die Sexualität zum Vergnügen und die Privatheit des Sexualaktes Indizien für eine stärkere Bindung des Mannes an eine Partnerin sind. Und von dieser Bindung, die mit der Entstehung der Kleinfamilie gleichzusetzen ist, profitiert auch der Nachwuchs des Paares.
Menschliche Kinder sind nämlich extreme Nesthocker und müssen im Vergleich zu Menschenaffen viel länger von ihren Eltern bis zur Eigenständigkeit betreut werden. Die bereits erwähnten langen und schnellen Läufe zu den Nahrungsquellen waren für Frauen mit ihren Kindern nicht mehr zu bewältigen. Umso mehr waren sie darauf angewiesen, dass die Männer nicht nur regelmäßig zur Horde zurückkehrten, sondern auch, dass diese sie und den eigenen Nachwuchs mit ausreichend mitgebrachter Nahrung versorgten. Dazu bedurfte es einer ausgeprägten persönlichen Bindung zu der jeweiligen Partnerin, die wahrscheinlich durch neue Gefühle wie Verliebtheit und schlussendlich auch durch Sex belohnt wurde. So ist auch der Orgasmus als intensiver sensorischer Klimax der geschlechtlichen Vereinigung nur bei Menschen nachgewiesen.
Dies alles mag in manchen Ohren sehr mechanistisch klingen und uns Menschen scheinbar wieder auf das Niveau triebgesteuerter Maschinen reduzieren, doch das Gegenteil ist der Fall: Wenn wir uns als Resultat einer langen Kette von Anpassungen an unsere Umwelt erkennen, dann wissen wir auch um unsere Talente und Schwächen. Und unsere Fähigkeit, bewusste Entscheidungen treffen und unsere Handlungen absichtlich gestalten zu können, selbst entgegen unseren archaischen Impulsen und Reflexen, macht uns erst zu dem, was wir sind: Menschen.
Bilder © pixabay