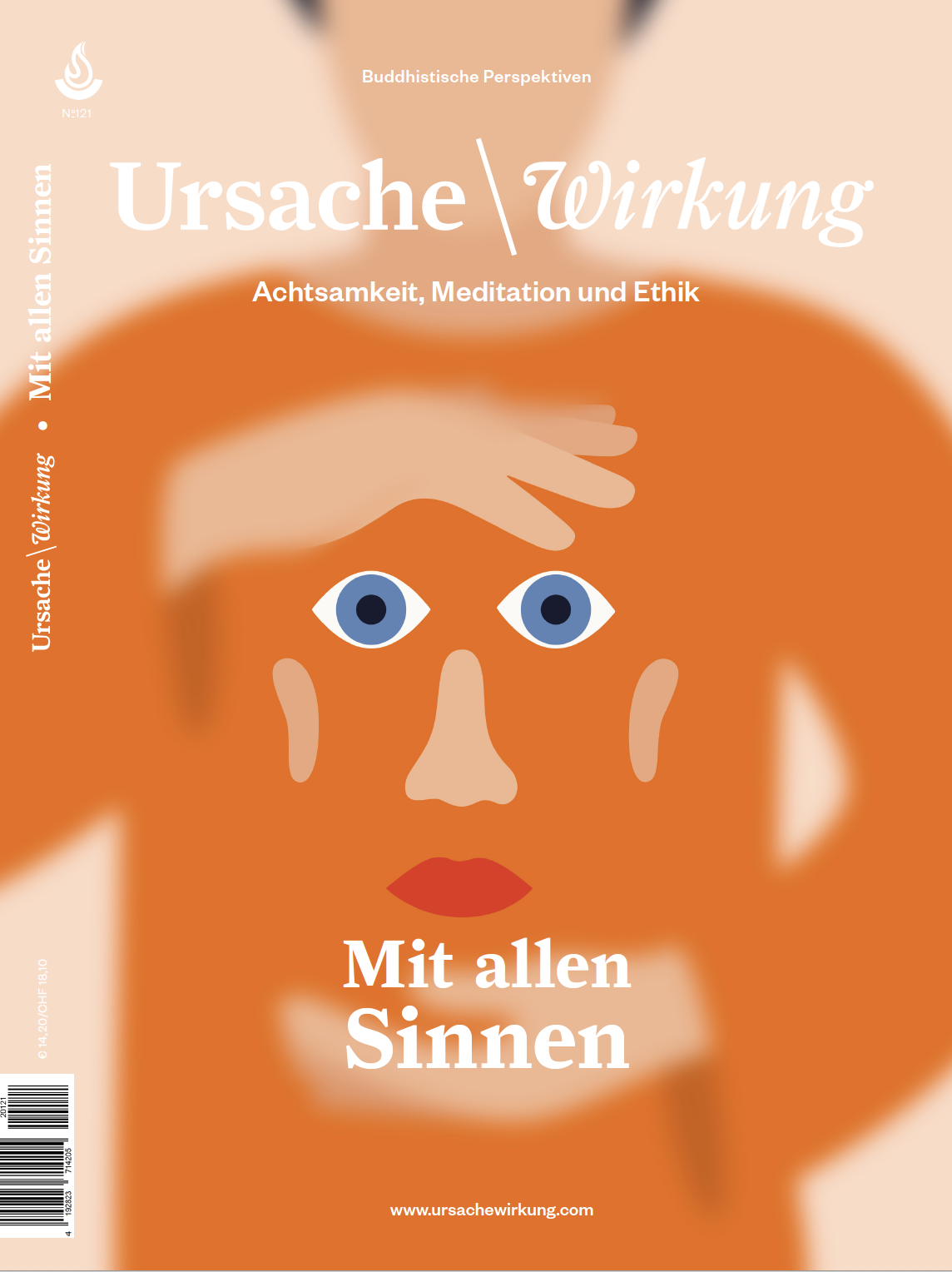Der Geruch des Waldes, das Rauschen des Meeres – Kraft schöpfen, indem man die Natur und die schönen Momente bewusst aufnimmt.
Ein Morgen im Sommer, fünf Uhr dreißig, der Kuckuck ruft. Die Sonne ist gerade hinter den Tannen erschienen. Unten im Tal hängt noch der Dunst; der Kirchturm spitzt heraus. Über mir wölbt sich ein Klangbogen aus Vogelstimmen, deren Verursacher ich nicht sehe. An den Gräsern hängt der Tau der Nacht, und die Welt am Morgen in den Bergen riecht wie frisch gewaschen.
Eine neue Welt, unschuldig und verheißungsvoll. Die Kühe rupfen am Gras mit sanft pendelnden Köpfen, ihre Glocken pendeln mit. Ich setze mich auf einen Stein und lausche dem Morgenkonzert, umsonst und draußen. Im Süden steht am Horizont der Schweizer Jura; ich weiß die Namen der Berge nicht und auch nicht den Namen des Raubvogels, der sich auf dem Zaun niederlässt. Für eine Stunde an einem Sommermorgen lebe ich im köstlichen Nichtwissen einer Welt, die ich nicht kennen und bewältigen muss, sondern mit allen Sinnen wahrnehmen darf.
Meistens genießen wir solche Momente und nehmen danach unseren Alltag wieder auf. Unsere Kräfte sind erfrischt, der Geist ist ausgeruht, aber uns ist nicht bewusst, dass wir gerade eine spirituelle Erfahrung gemacht haben.
In einigen buddhistischen Schulen gibt es die Meditationsanweisung, „die Sinnestore zu öffnen“. Ich mag dieses vielschichtige Bild. Ein Tor kann ein notwendiger Schutz sein oder ein Ding, das uns daran hindert, die Welt jenseits des Gewohnten wahrzunehmen. Wir allein haben den Schlüssel zu diesem Tor, und wir müssen lernen, ihn weise einzusetzen.
Es ist kein guter Gedanke, unsere Sinnestore sperrangelweit offen zu halten, wenn wir zum Beispiel am Fließband einer Werkhalle arbeiten oder am ersten Ferientag durch einen Großstadtbahnhof rennen, um den Zug zu erreichen. Da ist Fokussierung angesagt. Aber stellen wir uns vor, wir gehen abends am Meeressaum entlang, Möwen rufen, die Wellen umspülen unsere Füße. Die gesunkene Sonne hat am Horizont alle Schattierungen von Rot bis Blassrosa hinterlassen. Der Sand ist warm, unsere Zehen graben sich hinein. Wir sind „ganz Ohr“, „ganz Auge“. Da ist keine Instanz mehr, die einen Kommentar abgibt, ein Urteil fällt. Da sind nur Wahrnehmen, Staunen und ein Gefühl höchster Lebendigkeit.
Da sind nur Wahrnehmen, Staunen und ein Gefühl höchster Lebendigkeit.
Wir fühlen das Pulsieren des Lebens, das keine Grenze kennt zwischen innen und außen. Geschieht dieses Wahrnehmen durch das, was wir bisher als „Ich“ bezeichnet haben? Nein, sagt das Zen: Dein tiefes, wahres Selbst ist das Bewusstsein, das wahrnimmt. Es ist der Urgrund des Seins, und du brauchst nichts zu tun, um es zu erreichen. Du brauchst dich ihm nur zu öffnen.
Als ich nach acht Jahren im japanischen Zen zu Thich Nhat Hanh wechselte, lernte ich die Gehmeditation in der Natur kennen. Das war etwas völlig anderes als das Rennen zwischen zwei Sitzperioden, um die Beine beweglich zu halten. Gehmeditation heißt nicht, gemessenen Schrittes irgendwohin zu gehen, sondern mit jedem Schritt anzukommen. Wo komme ich an? In diesem Augenblick, der die einzige Zeit ist, die es gibt. Ich brauche den Augenblick nicht zu erreichen, er ist immer schon da.
Aber erst jetzt, im langsamen Schreiten, nehme ich die Fülle wahr, die jeder Augenblick bietet. Wie überraschend anders fühlt sich Sand unter meinen Füßen an als Gras. Noch nie habe ich diesen Strauch an der Mauer bewusst betrachtet. Und zum ersten Mal höre ich über mir ganz deutlich das Meer rauschen, wenn der Wind durch die Pappeln fährt.
Dein tiefes, wahres Selbst ist das Bewusstsein, das wahrnimmt.
Dies ist meine liebste Meditationsübung, für die ich kein Zafu brauche, keine Glocken, keinen Zendo: Ich praktiziere, mit jedem Schritt in der Gegenwart anzukommen. Aus dem japanischen Zen habe ich die Frage aller spirituellen Fragen mitgebracht, und die stelle ich nun mir selbst, während ich mit weit geöffneten Sinnestoren gehe: Wer ist es, die geht? Wer ist es, die sieht? Oder, was ich stimmiger finde: Was geht? Was sieht?
Dann beginnt vielleicht ein Vogel zu trillern, und der Klang läuft in Wellen durch meinen Körper, bringt alle Zellen ins Schwingen. Ich weiß einen Moment lang nicht, ob der Vogel auf dem Baum sitzt oder nicht vielleicht doch in mir: an einem Ort, den ich bisher nicht kennengelernt habe, der aber ein guter Ort ist für einen Vogel. Wenn die Sinnestore weit offen stehen, gibt es keine Grenze mehr zwischen innen und außen, zwischen „mir“ und „dir“. Wir Meditierende müssen uns ja oft den Vorwurf anhören, Nabelschau zu betreiben und unsozial zu sein. Aber was könnte sozialer sein als die gelebte Erfahrung der Allverbundenheit, für die Thich Nhat Hanh den Begriff „Intersein“ geprägt hat?
In den Höhenzügen der kolumbianischen Sierra Nevada lebt der Stamm der indigenen Kogi, die sich vor den spanischen Eroberern dorthin zurückgezogen haben. Sie leben seit Jahrhunderten, durch eine Zugbrücke von den Veränderungen in unserer Gesellschaft abgeschottet, auf ihre archaisch anmutende Weise. Der britische Filmemacher Alan Ereira hat im Auftrag der BBC einen faszinierenden Film über die Kogi gedreht. Er zeigt Menschen, die ihr Garn spinnen, ihre Stoffe weben und diese Stoffe zu schlichten Tuniken und Hosen verarbeiten. Und man sieht, wie sie jeden Morgen ihr Land begehen, langsam und mit dem Ausdruck höchster Konzentration. Sie schauen nicht umher, sie plaudern nicht, sie sammeln nichts auf; sie gehen konzentriert Schritt für Schritt. Ich staunte: In den Höhenzügen der kolumbianischen Sierra Nevada macht ein indigener Stamm jeden Morgen eine Gehmeditation!
Die Kogi sind seit Jahrhunderten auf uralten, heiligen Wegen unterwegs, aber sie haben kein Ziel, das sie erreichen wollen. Ein Stammesmythos erzählt vom Auftrag, der den Kogi am Beginn der Zeit erteilt wurde: „Ihr seid geschaffen, die Erde zu hüten und sie in Balance zu halten. Sammelt euren Geist und richtet ihn auf die Sorge für das Ganze.“ Die Kogi begehen ihr Land, um die Erde im Gleichgewicht zu halten.
Das ist mehr als eine hübsche Erzählung aus einer uns fremden Kultur, die vermeintlich nichts mit uns zu tun hat. Nachdem ich ein paar Wochen lang jeden Tag mit den Nonnen und Mönchen in Plum Village Gehmeditation gemacht hatte, war mein Geist klar und gesammelt. Ich sah Zusammenhänge im Naturkreislauf, die mir vorher entgangen waren. Nur ein klarer Geist kann Entscheidungen treffen, die das Leben auf der Erde schützen und bewahren.
Wenn wir mit allen Sinnen wahrnehmen, dass wir und „die Welt“ nicht getrennt sind, können wir gar nicht anders, als für die Erde zu sorgen. Wir betreten sie mit Respekt. Wir beuten sie nicht aus, denn damit würden wir uns ja selbst ausbeuten. Ihre Wuchsfreudigkeit unterstützen wir als sorgsame Gärtnerinnen und zerstören sie nicht als Eroberer. Wir nehmen dankbar an, was sie uns schenkt, und geben ihr dafür, was sie braucht, damit ihre Tiere, Pflanzen, Gewässer und Mineralien im Gleichgewicht bleiben. Denn nur dann sind auch wir im Gleichgewicht.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 121: „Mit allen Sinnen"
Nach elf Jahren auf dem Berg bin ich zurück in die Stadt gezogen. Ich habe keinen Gemüsegarten mehr, aber auf meinem Balkon ein kleines Biotop. Sehr gefragt bei Wild- und Honigbienen sind meine Nachtkerzen und Glockenblumen. Die Hummeln mögen den Wiesensalbei, und jeden Abend besucht ein Kohlweißling die Nachtviole, die übrigens bei Einbruch der Dämmerung betörend zu duften beginnt. Mein Balkon ist eine feine, kleine Wohngemeinschaft für die Geflügelten und mich. Leider kann ich jetzt nicht mehr mit weit geöffneten Sinnen einfach vor die Haustür treten; der Überfall durch Lärm und Hektik wäre zu heftig. Inzwischen gehe ich in „meinem“ Wald und „meinen“ Weinberg.
Aber Gehen muss nicht immer mit den Füßen geschehen. Durch die Musik von Arvo Pärt zum Beispiel kann ich im Geist meditierend spazieren ohne Sorge, dass mich eine Trompetenfanfare erschreckt. Im Sommer schwimme ich gern hinaus auf den See, und im Winter koche ich mir einen duftenden Tee. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Sinnestore zu öffnen und sich ganz auf den Augenblick einzulassen. Und dabei immer wieder einmal leise und auf die Antwort lauschend zu fragen: Was nimmt hier wahr?
Illustration © Francesco Ciccolella
Bild Header © Pixabay