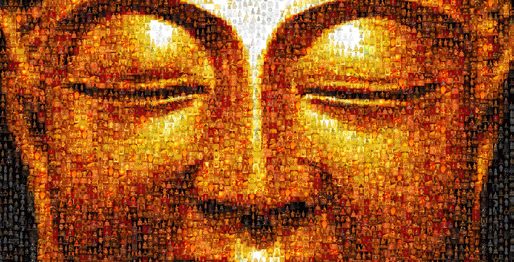Wie die Stille, das Staunen und die Ehrfurcht von meiner Kindheit bis heute nachwirken.
Viele Jahre lang sind Eltern ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens. Sie bieten Geborgenheit und Orientierung, auch wenn wir dies kaum wahrnehmen. Mit zunehmendem Alter verliert sich die Ursprungsfamilie im Nebel der Vergangenheit. Wir vergessen, wie sehr uns gemeinsame Erfahrungen geprägt haben.
Doch wenn wir den Zenit des Lebens überschreiten und innerlicher werden, knüpfen vergessene Bilder aus der Kindheit ein Band ins Heute, und ich merke, wie sehr das elterliche Vermächtnis mein Leben geprägt hat. Es sind die zufälligen, alltäglichen Ereignisse, die zählen.
Wenn ich an meinen Vater denke, leuchten verschiedene Szenen in meiner Erinnerung auf. Ein Spaziergang im Spätherbst in einer Allee: Der Weg war übersät von länglichen, schwarzen Johannisbrotfrüchten, die einen süßlich modernden Geruch verströmten. Mein Vater erzählte von Schopenhauer. Ich verstand davon nicht viel und war eher auf die Früchte und die raschelnden, braunen Blätter am Boden konzentriert. Doch die melancholische Stimmung gefiel mir.
Mein Vater liebte Spaziergänge in der wilden Natur des nördlichen Oberösterreichs. Er zog sich dafür zünftig an. Beigefarbene Knickerbocker, eine olivgrüne wetterfeste Jacke und auf dem Kopf einen abgewetzten Steirerhut. Durch den Nebel konnte ich kaum die Konturen der Fichten erkennen, die Äste hingen tief in den Weg hinein, es roch nach Feuchtigkeit und Waldwürze. Meistens schwiegen wir, sodass die Schritte in der Stille meine inneren Gedanken zur Ruhe schaukelten und ich mich den Gerüchen und den vielen Schattierungen des Lichts öffnen konnte. Ich mochte diese schweigsamen Wanderungen.

Eines Abends sagte er: „Morgen nehme ich dich auf eine Morgenwanderung mit. Ich wecke dich um fünf Uhr“. Fünf Uhr? Das war für mich mitten in der Nacht, außerdem waren Schulferien! Doch ich fügte mich. Also kam er frühmorgens ins dunkle Schlafzimmer und schüttelte mich aus dem Bett. Benommen und grantig zog ich mich an und tappte zur Haustür. Als sie mein Vater öffnete, standen wir in der glänzenden Morgensonne. Ich trottete ihm schlaftrunken hinterher, und es dauerte einige Minuten, bis ich meine schlechte Laune überwunden hatte. Doch dann explodierten meine Sinne. So hatte ich die Welt noch nie gesehen. Die Gräser bogen sich nass vom Tau, an ihren Enden schillerten die winzigen Wassertröpfchen in sämtlichen Regenbogenfarben. Das frühe Sonnenlicht brachte Frische auf alle Blumen und Bäume, ich atmete die ungewohnt kühle Luft und war bezaubert.
All das war keine Hexerei, ich war lediglich drei Stunden früher als sonst aufgestanden. Ich spürte, wie die Schlaftrunkenheit einem inneren Jauchzen Platz machte. Beschwingt holte ich meinen Vater ein. Wir schwiegen wie immer. Manchmal zeigte er mit der Hand auf eine Blume oder hob den Kopf, um dem Piepen eines Vogels zu lauschen. Mein Vater und ich waren im gemeinsamen Erleben verbunden – ganz ohne Worte.
Eben schlage ich mein Notizbuch auf. Mit achtzehn trug ich folgendes Gedicht des Japaners Osawa Roan aus dem 17. Jahrhundert darin ein.
„Ach, auf dieser Welt
ist das Glück so wie der Tau
auf dem Morgengras,
der nur glitzert, bis der Wind
kommt und ihn herunterweht.“
Meine Mutter vererbte mir die Regsamkeit, mein Vater lehrte mich den Wert des Innehaltens. Er arbeitete hart, war als Dirigent viel unterwegs und musste sich alle paar Tage auf neue Hotelzimmer, neue Menschen, unterschiedliche Gepflogenheiten und andersartige Kommunikation einstellen. Ein Konzert in Norwegen, ein paar Termine in Frankreich, dann wieder Wochen in Indien, Korea und Japan. Es war sicher nicht einfach für ihn, sich jedes Mal wieder auf ein neues Orchester einzustellen, in ein paar Proben seine Interpretation eines Musikstückes einzuüben. Dazu kamen die Zeitumstellung und die Anspannung an den Konzertabenden. Er wusste, dass er zwei Stunden lang Tausende Augenpaare im Rücken haben würde und vor ihm die Musiker, die er zu Höchstleistungen bringen musste. Das war Stress und Schwerstarbeit. Deshalb brauchte er die Stille und das Innehalten in seinen freien Zeiten als Ausgleich. Diesen Rhythmus beherrschte er wie kein anderer. Er hielt Siesta, er ging regelmäßig spazieren und erholte sich bei Museumsbesuchen.
Meditation im Museum
Denn ja, er liebte darstellende Kunst! Er verriet mir einmal, dass er künstlerisch uninteressante Angebote mit zweitklassigen Orchestern gerne akzeptierte, wenn es in der betreffenden Stadt ein interessantes Museum gab. Auf diese Weise lernte er auch kleinere Städte in Asien und Europa kennen.
Wenn andere Menschen am Sonntagvormittag in die Kirche gingen, hielt er seinen Gottesdienst vor Gemälden von Raffael oder Monet ab. Manchmal war ich dabei, beobachtete meinen Vater, wie er zuerst das Bild von der Ferne aus betrachtete, um es im Ganzen wahrzunehmen, und dann Schritt für Schritt näherkam. Er tastete jedes Detail eines Gemäldes mit den Augen ab, trat dann wieder ein paar Schritte zurück, um es in seiner Gesamtheit wirken zu lassen. Es war wie eine Übung der Achtsamkeit: betrachten, wahrnehmen und sich fragen, was das Betrachtete im Inneren auslöst.
An diese Museumsbesuche erinnere ich mich mit einem Gefühl der Ehrfurcht. Die hallenden Schritte in den hohen Räumen, wenn die Besucher/Kunstliebhaber von einem Bild zum anderen schritten, das leise Flüstern der Paare, die sich über ihre Beobachtungen austauschten. Im Unterschied zur Kirche war hier jeder Besucher Hohepriester. Keine Lieder und keine Klingelbeutel störten die Anbetung. Jedes Kunstwerk war ein Altar für die Kommunion mit dem Göttlichen.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 110: „Familienbande"
An Samstagabenden nahmen mich meine Eltern oft mit ins Konzert. Für sie war das eine Notlösung, weil sie mich nicht alleine zu Hause lassen wollten, für mich war es meist langweilig. Ich hörte nicht zu, sondern dachte über die nächste Prüfung in der Schule nach oder kämpfte gegen meine Müdigkeit an.
Dann aber erzählte mir mein Vater einmal bei einem Spaziergang, dass Anton Bruckner für Gott komponierte. Eine Symphonie als Gebet. Er verriet mir, dass die Musik auch ihn in Räume des Unaussprechlichen führt. Mit diesem Satz öffnete er mir ein Tor zu einer anderen Welt. Wenn ich im Konzertsaal den übereinandergetürmten Klanggebäuden einer Bruckner Symphonie lauschte und die Steigerung mit den weit ausholenden Gesten meines Vaters am Dirigentenpult beobachtete, dann spürte auch ich plötzlich Ehrfurcht. Wofür, war mir nicht klar, aber das Gefühl war da.
Diese Bilder aus den gemeinsamen Momenten mit meinem Vater haben mein Leben geprägt. Wenn ich heute um vier Uhr morgens durch die regennasse Wiese in die Meditationshalle zu meinen Zen-Kollegen gehe, die Dämmerung über den Bergen einatme und die erwachenden Vogelstimmen höre, dann klingt der erste frühe Morgenspaziergang mit meinem Vater nach. In Museen und bei Naturspaziergängen habe ich eine behutsame Art des Schauens und Staunens gelernt, und die Musik hat mein Herz für eine wunderbare Welt geöffnet.
Bild Header © unsplash
Bild klein © pixabbay