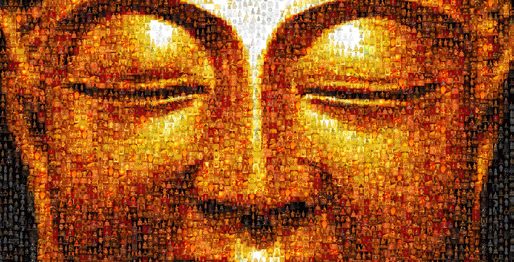Der deutsche Psychiater und Psychotherapeut Mathias Berger über die Ursachen der Depression und die sinnvollen Möglichkeiten der Behandlung.
Nehmen Depressionen im Vergleich zu früher zu?
Das ist nicht leicht zu beantworten, da die Dunkelziffer depressiv Erkrankter sehr hoch ist. Nur bei jedem zweiten bzw. dritten Patienten erkennt der Hausarzt die Erkrankung. Dies war in der Vergangenheit ein noch größeres Problem. Da das Stigma einer Depression jedoch rückläufig ist, sind Patienten inzwischen eher bereit, über ihren seelischen Zustand zu sprechen. Auch Ärzte fragen öfter nach, wenn die körperlichen Beschwerden die gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht erklären. Trotzdem können wir davon ausgehen, dass die leichten bis mittelschweren Erkrankungsformen zunehmen. Schwere Depressionen bleiben dagegen wohl auf dem gleichen Niveau. Das Risiko einer krankhaften Schwermut gehört zum Leben. So weit die Menschheit zurückdenken kann, musste sie gegen diese Krankheit ankämpfen. Gesellschaftliche Strukturen – das steht außer Frage – sind mitverantwortlich für ein Zunehmen dieser psychischen Störung. Häufige Wohnortwechsel und der damit verbundene Verlust von sozialen Kontakten, eine extreme Verdichtung des Arbeitsdruckes, die Instabilität von familiären Zusammenhängen, aber auch Arbeitslosigkeit scheinen die ‚Anfälligkeit' der Menschen zu erhöhen.
Worin sehen Sie die Ursachen in der Entstehung von Depression?
Die Entstehung von Depressionen wird am besten mit dem sogenannten ‚Vulnerabilitäts-Stress-Modell' erklärt. Unter Vulnerabilität versteht man die individuelle Verwundbarkeit, also die Wahrscheinlichkeit, in bestimmten Stresssituationen eine Depression zu entwickeln. Diese Verletzbarkeit hängt erstens stark von der Genetik ab, also ob eine Veranlagung zur psychischen Erkrankung vererbt wurde. Zweitens spielen auch vergangene Erlebnisse eine Rolle. Musste man als Kind viele belastende Erfahrungen durchmachen, steigert sich ebenfalls die Empfindsamkeit in Stresssituationen im Erwachsenenalter. Menschen mit einer sehr hohen Verletzlichkeitsausprägung können sogar bei einer harmlosen Viruserkrankung oder bei einem Wechsel der Jahrszeiten eine starke Depression entwickeln, hingegen neigen Personen mit einer niedrigen ‚Vulnerabilität' – selbst in den belastendsten Situationen – nicht zu krankhaften Depressionen. Vieles ist somit von jenem Teil des Schicksals, also Genen und frühen Kindheitserfahrungen, abhängig, für den man letztendlich nicht verantwortlich ist. Deshalb ist eine Stigmatisierung depressiver Menschen gänzlich ungerechtfertigt.
Werden grundsätzlich immer noch zu früh Medikamente verschrieben?
Ich denke schon, aber es hängt auch von der Präferenz der Patienten ab. Ältere Menschen und Männer nehmen lieber Tabletten ein, als sich für eine Psychotherapie zu entscheiden, jüngere Frauen hingegen stehen Antidepressiva skeptisch gegenüber. Es hat sich außerdem gezeigt, dass bei leichten Depressionen antidepressive Medikamente oft nicht mehr als eine Placebowirkung haben. Stützende Gespräche, psychotherapeutische Behandlungen scheinen hierfür sinnvoller zu sein. In der Regel kann man als Arzt, außer bei schwereren Depressionen, auf Medikamente verzichten, wenn Zeit und Qualifikation zu psychologischen Behandlungen vorhanden sind. Allgemein gilt: Bei Depressiven gibt es einen sehr starken Placeboeffekt, also jede Art von Zuwendung oder jede Art von Behandlung kann bei einer leichten Erkrankung zu einer Besserung führen. Deswegen ist bei einem leichteren emotionalen Ungleichgewicht eher kompetente hausärztliche Zuwendung zu empfehlen.
Depressionen werden oft um Jahre zu spät entdeckt, weil sie als somatische Erkrankungen behandelt werden. Was sind derartige Erkrankungen, die nicht als depressiv bedingt erkannt werden?
Früher gab es den Begriff der lavierten, also der maskierten Depression. Dieser Ausdruck ist deshalb gut, weil Depressionen oft mit körperlichen Beschwerden einhergehen oder getarnt als Schmerzen auftreten. Rücken- und Magenschmerzen, Herz-Rhythmusstörungen oder auch Schwindel und Durchfall sind oft genannte Zustände. Wegen dieser körperlichen Beschwerden suchen die Patienten dann zum ersten Mal einen Arzt auf. In der Tat: Es kann mitunter lange dauern, bis diese sogenannten ‚funktionellen Beschwerden', bei denen keine organische Ursache gefunden werden kann, psychiatrisch-psychosomatisch hinterfragt werden und eine genaue Anamnese stattfindet. Lässt sich kein somatisches Korrelat finden, steht die Behandlung der Psyche im Vordergrund.
Welche Behandlungsmethoden – neben der Psychotherapie und der Einnahme von Medikamenten – kommen Ihrer Meinung nach noch infrage?
Im Moment spricht man sehr oft von der Wirkung von Sport auf den Gemütszustand. Viele Menschen entwickeln durch sportliche Betätigung Glücksgefühle bzw. eine Besserung ihrer Stimmung. Bei schwerer depressiv Erkrankten muss allerdings der Körper sehr langsam wieder belastet werden, da der allgemeine Trainingszustand meist schlecht ist. Bei bereits leichtem Training wird rasch Milchsäure ausgeschüttet und körperliche Erschöpfung stellt sich ein. Oft wird dies dann als ein Rückfall in die Depression missgedeutet.
Ist es möglich, den Rückfall in eine Depression vorherzusagen?
Bei vielen Depressiven ist der Cortisolspiegel, also das Stresshormon, erhöht. Durch Cortisol kann die depressive Symptomatik aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden. In Studien am Münchner Max-Planck-Institut konnte Folgendes gezeigt werden: Bei antidepressiv behandelten Studienteilnehmern, die sich zwar subjektiv besser fühlten, gleichzeitig aber noch ein hohes Niveau an Stresshormonen aufwiesen, stieg die Rückfallswahrscheinlichkeit an. Im Moment gibt es noch keine abschließende Bestätigung für diese Berichte, aber es spricht sehr viel für diese Annahme.
Nach der buddhistischen Erkenntnis gehen die ‚Dinge' vom Geist aus. Trifft das nicht ganz besonders auf die Depression zu?
Chronisch Depressive mussten in ihrer Kindheit oft Katastrophales ertragen: Misshandlungen, körperliche Gewalt oder Vernachlässigung. Das Verhalten der Bezugsperson war – und zwar unabhängig vom Verhalten der betroffenen Kinder – einmal gut und einmal böse, d.h. die Strafen kamen zufällig und unvorhersehbar. Resignation und ein Gefühl der Hilflosigkeit sind oft die Folge –negative Gedankenketten entstehen und halten dadurch die negative Stimmung aufrecht. In einer psychotherapeutischen Behandlung sollten diese depressiv-negativen Gedankenschleifen durchbrochen werden. Der Patient braucht die Erfahrung, dass er sehr wohl andere durch sein Verhalten, d.h. in seinem Sinne, beeinflussen kann. Dadurch kann sich das Gefühl der Ohnmächtigkeit verringern und Selbstbewusstsein aufbauen.
Gibt es Untersuchungen zur Wirkung von meditativen Praktiken?
Dazu gibt es sehr viele Untersuchungen. Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen werden immer bedeutungsvoller, da bereits sehr gute wissenschaftliche Evidenzen vorliegen. Gerade meditative Praktiken wie das ‚Mindfulness Based Stress Reduction Program' (MBSR) des Amerikaners Jon Kabat-Zinn oder die ‚Mindfulness Based Cognition Psychotherapy' bei rezidivierenden Depressionen sind hier zu nennen. Achtsamkeitsprogramme werden immer häufiger als additive Behandlungsmaßnahmen in der Psychotherapie eingesetzt, so dass Rückfälle vermieden werden können.