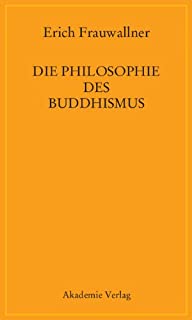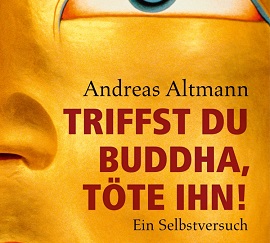Der Anwalt Klaus Rüther ließ sich mit 71 Jahren zum Zen-Mönch ordinieren und trägt jetzt in seiner Sangha nicht nur mehr Verantwortung, sondern auch den Namen „To En Kanzan“.
Wie war Ihre Ordination?
Spannend … Der Ablauf hatte noch keine Routine bei uns im Tempel. Es war ein wichtiger Einschnitt in meinem Leben, vergleichbar mit meinem Staatsexamen. Die Zeremonie war sehr ergreifend. Auch meine Familie war anwesend. Ich kann es nicht in Worte fassen, was da innerlich in mir abgelaufen ist.
Was hat sich danach geändert?
Ich kümmere mich jetzt sehr viel mehr gedanklich und inhaltlich um die Entwicklung der Choka Sangha und To Gen Ji, den Tempel. Ich bin auch für die Finanzen zuständig und schaffe somit den Rahmen, damit alle ihre Sesshins abhalten können. Wir stehen derzeit an einer Wegscheide: Werden wir ein buddhistisches Seminarhaus, mit dem schon bestehenden Permakulturgarten und der Permakulturausbildung, oder werden wir ein Zen-Kloster?
Was ist Ihre Aufgabe dabei?
Ich beschäftige mich, welche Regeln im Zen-Kloster gelten würden. Zwei Fragen haben es mir da besonders angetan: Wovon leben die Personen im Kloster? Und welche Regeln gibt es für das Zusammenleben?
Leben Sie im Tempel?
Nein, ich bin in einer glücklichen Beziehung und wohne gemeinsam mit meiner Frau. Vor meiner Ordination wollte ich den Anwaltsberuf ganz aufgeben, aber es hat nicht geklappt. Einige Fälle sind wegen Corona hängen geblieben. Ich will auch weiterhin buddhistische Organisationen in rechtlichen und steuerlichen Dingen beraten, also mein Wissen an Steuer-, Gemeinnützigkeits- oder Vereinsrecht zur Verfügung stellen.
Bleibt da noch Zeit für die Praxis?
Ich stehe früh auf, so habe ich viel Zeit zum Meditieren und Lesen. Ich will das, was ich kann, einbringen, das gehört zum Mönchsein dazu. Seit meiner Ordination fühle ich mich mehr verpflichtet. Ich nehme auch vermehrt an Sesshins teil, bei denen ich vorne sitze und ein Ansprechpartner für Anfänger bin.
Unterrichten Sie auch?
Nein, das können andere besser. Das Organisatorische ist viel mehr meins. Ich lehre nur auf einer kleinen Anfängerebene, gemeinsam mit einer laienordinierten Frau. Dharmanachfolger zu werden, ist nichts, was ich anstrebe. Menschen, die organisieren können, gibt es nicht so viele. Es tut gut, etwas Sinnvolles zu tun, denn es ist das Einzige, was bleibt. Alle müssen sterben und wir können ja nichts mitnehmen. Durch meine Handlungen kann ich etwas schaffen, an dem junge Menschen wachsen können.

Wann sind Sie zum Zen gekommen?
Mein erster Kontakt mit der Meditation war während meines Studiums in Göttingen, da war ich 28 Jahre alt. Nach dem Studium, als junger Anwalt, habe ich einen Ort zum Meditieren gesucht. Anfangs war ich in einer kirchlichen Zen-Gruppe von Pater Lassalle. Irgendjemand hat mich dann auf Zen in Norddeutschland aufmerksam gemacht. Das war 1985 und ab da bin ich beim Rinzai Zen geblieben und bei meinen zwei Lehrern Raphael Nolting und Christoph Hatlapa.
Haben Sie von da an regelmäßig praktiziert?
Zu der Zeit habe ich auch meine Anwaltskanzlei aufgebaut, daher habe ich nicht immer gleich intensiv praktiziert, aber ich bin kontinuierlich dabeigeblieben. Wenn man einmal auf Sesshins war, zieht es einen immer wieder hin. Du weißt, das gibt es, du weißt, du brauchst es. Es ist sinnvoll für dich. Wenn du meinst, du hast aber eigentlich keine Zeit, an dem nächsten Sesshin teilzunehmen, ist das Quatsch.
Ihr Beruf als Anwalt und Zen, wie passt das zusammen?
Zen ist ein sehr guter Ausgleich zum Strafverteidiger-Dasein. Eine Woche lang zu schweigen, ist das absolute Gegenteil zu dem, was man als Anwalt tut. Man entspannt sich und ist auf sich geworfen. Es schafft auch Abstand, wenn man zu nahe an eine Person oder Situation geraten ist. Empathie ist das eine, aber sich in der Not der Menschen zu verlieren, denen du hilfst, ist etwas anderes.
Warum haben Sie sich nach so vielen Jahren als Laie ordinieren lassen?
Im Jahr 1994 habe ich Zuflucht genommen. Drei Jahre später habe ich von Raphael Nolting die Laienordination bekommen. Den Entschluss, mich voll ordinieren zu lassen, habe ich bei der Weltausstellung in Hannover im Jahr 2000 gefasst. Wir haben dort den Bhutan Tempel betreut und Einführungen in die Meditation gegeben. Das hat mich dann auch motiviert, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Ich war schon lange dabei und wollte mein Commitment und meine Verbundenheit zeigen sowie mehr Verantwortung übernehmen. Und so fragte ich unseren Roshi Christoph To Toku Rei Ho Hatlapa, ob er mich ordinieren will.
Und was war seine Antwort?
Er sagte zu, wollte die Zeremonie aber in Japan durchführen. So sind wir 2001 nach Japan gereist. Dort angekommen wollte mich der Roshi nicht mehr ordinieren, da er meinte, er habe so viele Ausländer ordiniert und die meisten habe er danach nie wieder gesehen. Eine Ordination in einem Tempel bedeutet aber, dass man dem Tempel zugehörig ist und dort auch arbeitet. Zum mitgereisten Christoph Hatlapa sagte er schließlich, er soll einen Tempel in Europa bauen und mich dann dort ordinieren.
Wie ging es dann weiter?
Ich wollte am Tempelbau mitwirken. Ich habe anscheinend nicht durch Zufall den Laienmönchsnamen Kanzan bekommen. Normalerweise bekommt man eine Silbe von seinem Lehrer und dem wird eine weitere hinzugefügt. Meiner hätte somit mit „Ho“ beginnen sollen. Der Begründer des Hauptklosters des Rinzais in Kyoto war Kanzan Egen. Er war eine wichtige Figur im Rinzai Zen. So sah ich meinen Auftrag. Ich sollte auch einen Tempel bauen, in Deutschland.
Wie haben Sie dies geschafft?
Ich habe eine Fundrasing-und-Public-Relations-Ausbildung gemacht, um das Geld für den Tempel zu besorgen. Als der Tempel, „To Gen Ji“ genannt, 2016 eröffnete, hätte ich sofort ordiniert werden können, aber ich wollte einen Moment innehalten. Ich fragte mich, ob ich dies überhaupt noch wollte. Sechzehn Jahre waren in der Zwischenzeit vergangen. Christoph Hatlapa und weitere Personen aus unserer Sangha überzeugten mich jedoch. Sie meinten, wenn sich wer für die Sache eingesetzt hat und es verdient, dann ich. Bei der Ordinationsfeier 2021 wurde mir gesagt, ich bin durch meine Geduld und Ausdauer ein Vorbild für die Jüngeren. Alles geht nicht immer so schnell wie erhofft. Es ist wie im Zen selbst und bei der Frage der Entwicklung des eigenen Bewusstseins.
Bilder © Klaus Rüther