Wie man Zufriedenheit zu messen versucht, und warum weniger manchmal mehr ist. Schon Buddha wusste, dass es klüger ist, Extreme zu vermeiden.
„Die Welt ist nicht genug“, so lautet der ironische Titel eines James-Bond-Klassikers von 1999. Diese Einstellung scheint aber manchen Menschen ganz ernst zu sein, wenn es um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse geht. Nach sechzig Jahren des ungebremsten Wirtschaftswachstums nach zwei Weltkriegen haben wir uns in Europa an die falsche Vorstellung gewöhnt, dass Ressourcen, wie Essen, Energie und Mobilität, uneingeschränkt verfügbar sind. Jeder fordert für sich materiellen Wohlstand.
Die Geschichte unseres Überkonsums ist dabei noch gar nicht alt.
Worte wie „Verzicht“, „Einschränkung“ oder „Reduktion“ kommen in Wahlkampfreden deshalb nicht vor, denn sie würden keine Zustimmung erhalten. Um stetes Wirtschaftswachstum abzusichern, müssen in einer modernen Konsumwelt zudem immer noch weitere Bedürfnisse erzeugt werden.
Die Geschichte unseres Überkonsums ist dabei noch gar nicht so alt. 1973 schockte der französisch-italienische Spielfilm „Das große Fressen“ die bürgerliche Gesellschaft. Er führte mit dem Stilmittel der starken Übertreibung die Folgen des Exesses vor. Die Geschichte handelt von vier Freunden, die im Lauf eines Wochenendes durch maßloses Essen, ungezügelte sexuelle Ausschweifungen und Gespräche über ihre Konsumgier einer nach dem anderen zugrunde gehen. Damals wurde diese Inszenierung einer in ihren Bedürfnissen nie zu befriedigenden Gesellschaft von der Kritik als dekadent, voller Selbsthass und Überdruss, als zynisch und obszön zurückgewiesen.
Wo stehen wir jetzt, fast fünfzig Jahre später? Stellen wir uns endlich der von vielen als unangenehm empfundenen Frage, was und wie viel benötigt wird, um zufrieden zu leben? Unangenehm ist diese Frage deswegen, weil sich Zufriedenheit im Leben nicht etwa automatisch einstellt. Sie muss sich in der ständigen Auseinandersetzung mit der Unzufriedenheit behaupten.
Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung, die versucht, zwischen Ansprüchen der Ökologie, der Ökonomie und sozialen Aspekten auszugleichen, ist in den letzten zwei Jahrzehnten auch international von allen 196 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verstanden worden. Aber etwas zu verstehen, bedeutet nicht automatisch, auch danach zu handeln. Deswegen sind die Fortschritte hin zu einer Welt, die unseren Nachfahren noch die gleichen Naturräume bietet, bescheiden geblieben. Themen wie Artensterben, Klimakrise und Ressourcenausbeutung bedrohen nach wie vor unsere und vor allem ihre Zukunft.

Menschen brauchen ständig leichte Herausforderungen, die sie beschäftigen, aber nicht stressen.
Jetzt zeigt ein neuer, akzentuierter Begriff, der immer häufiger in den entsprechenden Debatten auftaucht, worauf es eigentlich ankommt: „Suffizienz“. Dieser steht dafür, dass etwas im richtigen, gesunden Maß funktioniert. Im medizinischen Bereich etwa wird mit der „Insuffizienz“ die Schwäche eines Organs bezeichnet. Die Suffizienz unserer Lebenswirklichkeit erfordert kritisches Nachdenken über den eigenen Konsum. Brauche ich wirklich alles, was ich mir leiste? Man könnte Suffizienz auch mit „Genügsamkeit“ oder mit einem Begriff, der bei vielen Menschen Ängste auslöst, übersetzen: „Verzicht“. Gemeint ist in diesem Zusammenhang aber nicht das Fehlen von etwas, sondern eine selbst gewählte Einschränkung, die man eben nicht als Verlust empfindet. Sie trägt vielmehr zur Lebensqualität und damit zur eigenen Zufriedenheit bei.
Da aber Zufriedenheit eine sehr subjektive Empfindung ist, beschäftigen sich Sozialwissenschaft, Marktforschung und die Politik mit der Frage, wie man so ein Gefühl beziehungsweise Geisteszustand, quantifizieren kann. Am einfachsten ist es, bei Erhebungen im Bereich der Kunden- oder Arbeitszufriedenheit nur die „Abwesenheit von Unzufriedenheit“ abzufragen. Manche Forscher definieren Unzufriedenheit als „Nichterfüllung der gestellten Erwartungen“. Auf diese Weise lassen sich Fragen leichter formulieren, wenn nur die Differenz zwischen Erwartung und dem Erfüllungsgrad dieser Erwartungen dargestellt wird. Die Logik dahinter: Werden die individuell unterschiedlich hohen Erwartungen eines Menschen erreicht oder sogar übertroffen, dann empfindet man ein Gefühl der Zufriedenheit.
Einen anderen Zugang hat der ungarische Glücksforscher Mihály Csíkszentmihályi entwickelt. Die Testpersonen sollten immer, wenn ein Timer an ihrem Handgelenk ein Signal gab, ihren Gefühlszustand und die Situation, in der sich gerade befanden, aufschreiben. Er erkannte, dass Menschen unabhängig von ihren allgemeinen Lebensumständen – arm oder wohlhabend, Arbeiter oder Akademiker, in Europa oder Afrika – immer dann zufrieden und glücklich waren, wenn sie gerade in eine Tätigkeit völlig vertieft waren, die einerseits ihre Konzentration erforderte, sie aber gleichzeitig nicht überforderte. Er nannte diesen Zustand Flow, englisch für „fließen“, „strömen“. Dieser Theorie nach brauchen Menschen ständig leichte Herausforderungen, die sie beschäftigen, aber nicht stressen. Ein Zweig der Psychologie, die Evolutionäre Emotionsforschung, sieht dieses Phänomen in der menschlichen Stammesgeschichte begründet. Der Homo sapiens musste sich seit seinem Exodus aus Ostafrika ständig neuen Umweltsituationen anpassen. Dazu war eine neugierige, experimentierende Lebensweise von Vorteil gegenüber Artgenossen, die sich konservativ nur auf tradierte Verhaltensweisen und bewährte Abläufe verließen. Explorative Menschen hingegen fühlen sich schnell unterfordert und verfallen in Langeweile, wenn sie keine Gelegenheit haben, Neues zu erproben. Aus diesen Gründen fühlen sich heutige Menschen in Situationen, die ein mittleres Maß an Herausforderung haben, am ehesten wohl und zufrieden.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 118: „Zufriedenheit"
Dies gilt auch für Haustiere. Menschen haben sie über Jahrtausende danach ausgewählt, bestimmte Leistungen für sie zu erbringen . Ein bekanntes Phänomen im Tierschutz ist zum Beispiel, dass aus schlechten Haltungsbedingungen befreite Zirkus- oder Lastenpferde, die dann nur im Stall herumstehen, ihre täglichen Arbeitsabläufe vermissen und in einen depressiven Zustand verfallen. Bei Zootieren verhält es sich ähnlich. Sie sind nicht nur dann zufrieden, wenn sie regelmäßig gefüttert werden, sondern sie brauchen ebenso im richtigen Maß Herausforderungen. Es ist also immer die Mitte, die Zufriedenheit erzeugt. Das wusste schon Buddha vor rund 2.500 Jahren, der mit seinem „Mittleren Weg“ darauf hinwies, dass es klug sei, Extreme zu vermeiden. Dazu fällt mir ein Spruch meines Philosophielehrers im Gymnasium ein: „Weniger ist manchmal mehr.“ Wobei er damit nicht versuchte, uns zur Mäßigung in unserer Lebensgestaltung zu bewegen, sondern den Lärmpegel im Klassenraum zu begrenzen.
Bild Teaser & Header © Pixabay







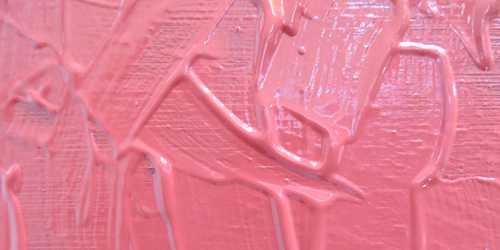



Wenn wir bekommen, was wir wollen, ist es meistens doch nicht genug. Unser Geist hält dauernd nach Dingen Ausschau, die er zusätzlich zu brauchen meint, um sich ausgefüllt und zufrieden zu sein.
Aus diesem Grund ist er meistens nicht lange zufrieden damit, wie die Dinge sind, selbst dann, wenn eigentlich alles ganz erfreulich und harmonisch ist.
Eine Nachhaltige Lebensweise ist dann, bei den allgegenwärtigen
konsumistischen Verführungen und der Gier immer mehr haben zu wollen, schwierig, aber erforderlich, wenn wir den nachfolgenden Generationen keine zerstörten lebensnotwendigen natürlichen Lebengrundlagen (Ökosysteme) hinterlassen wollen.
Mit freundlichen, aberglaubensfreien, heilsamen, buddhistischen Grüßen, auf eine bessere Zukunft.
Uwe Meisenbacher