Angststörungen sind extrem häufig, lassen sich aber erfreulicherweise sehr gut behandeln.
Es kommt von einer Sekunde auf die andere und scheinbar aus heiterem Himmel. Zuerst ist da ein leichtes Schwindelgefühl, das Herz beginnt zu rasen, am ganzen Körper bildet sich kalter Schweiß. „Es ist dieses Gefühl, ohnmächtig zu werden, fast wie Sterben“, beschreibt es Martina H. (Nachname der Redaktion bekannt), die immer wieder von Panikattacken heimgesucht wird. Es trifft sie jedes Mal aufs Neue unvorbereitet: beim Einkaufen, im Auto oder unlängst im Büro, als ein früherer Kollege auf einen Plausch vorbeischaute und sie sich eigentlich freute. „Ich kann mir nicht erklären, woher das kommt“, sagt sie. Für solche Notfälle hat der Arzt ihr ein Beruhigungsmittel verschrieben.
Es ist dieses Gefühl, ohnmächtig zu werden, fast wie Sterben.
Martina weiß, dass es bei regelmäßigem Gebrauch abhängig machen würde, und nimmt es deshalb wirklich nur in Notfällen. Es sei ein gutes Gefühl, diese Tabletten in der Handtasche zu haben, sagt sie, weiß aber gleichzeitig, dass sie ihre Angst langfristig nur mit psychotherapeutischer Hilfe in den Griff bekommen kann. Und genau das nervt sie noch mehr. „Warum kann mein Leben nicht einfach unbeschwert sein? Ich habe doch eigentlich keine großen Probleme“, betont sie und trifft einen zentralen Punkt: Angst entsteht unbewusst, ist fast ein Instinktprogramm und weil der Mensch ein Gedächtnis hat, kann Angst mit der Lebenserfahrung mitunter auch stärker werden.
Denn im Grunde genommen ist das Gefühl der Angst eine überaus positive Sache, weil sie evolutionär betrachtet das Überleben sichert. Vögel haben Angst vor Katzen, Antilopen vor Löwen und Menschen zum Beispiel vor Schlangen. „Wer sich fürchtet, lebt länger“, erklärt der Psychiater Georg Psota, Chef des Psychosozialen Dienstes in Wien. Denn Angst schärft alle Sinne, lässt den hochkomplexen Organismus blitzschnell auf Gefahren reagieren. Im Kampf ums Überleben ist das überaus vorteilhaft. Angst lässt uns schneller reagieren und hält dazu an, uns in Sicherheit zu bringen.
Allerdings: Tatsächlich existenzielle Gefahren sind im 21. Jahrhundert selten, zumindest in Mitteleuropa. Und gerade deshalb ist es umso erstaunlicher, dass viele Menschen an Angststörungen leiden. Sie sind die häufigsten psychischen Erkrankungen: 14 Prozent der europäischen Bevölkerung erkranken daran. Das sind mehr als 61 Millionen Menschen. Auf der Suche nach einer Erklärung für dieses Phänomen sind sich führende Wissenschaftler einig, dass es sich immer um ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren handelt. Da Angststörungen von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein können, hält man sich bei der Ursachenfindung an das biopsychosoziale Modell. Zum einen sind es genetische Faktoren, die das Empfinden von Angst regulieren. Konkret sind es Varianten des Gens GLRB (Glycinrezeptor B), die eine Schlüsselrolle bei der Aktivierung des ‚Furchtnetzwerkes‘ im Gehirn spielen, haben deutsche Wissenschaftler herausgefunden.

Aber nicht nur die Gene als biologische Grundkonstanten, sondern auch die eigene Lebensgeschichte spielt bei Angstanfälligkeit eine Rolle. Auch die individuelle Biografie hinterlässt Spuren. Traumatische Eindrücke, schlechte Erlebnisse oder unglückliche Lebensverhältnisse prägen die Art, wie ein Mensch mit den Anforderungen des Lebens zurechtkommt. Und schließlich trägt auch ganz Alltägliches unbewusst zum Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit bei. Stress, Schlafmangel, zuckerreiche oder insgesamt schlechte Ernährung, überbordende Smartphone-Nutzung, Bewegungsmangel, zu wenige Ruhezeiten und Muße: All diese ganz normalen Dinge des Lebens können die Anfälligkeit für Angststörungen fördern.
Rein physiologisch ist die Amygdala, also der tief im Gehirn liegende Mandelkern, das Angstzentrum, in dem Reize aus der Umwelt verarbeitet werden. Doch diese Reize, die von den Augen, den Ohren, der Nase und dem Tastsinn in der Haut registriert werden, treffen nicht unmittelbar auf die Amygdala, sondern werden im präfrontalen Cortex, der weiter außen im Gehirn liegt, registriert und gefiltert. Die US-Wissenschaftler Olena Bukalo und Andrew Holmes vom Laboratory of Behavioral and Neuroscience in Rockville haben eindeutige Hinweise darauf, dass es bei Angstpatienten in der Kommunikation dieser beiden Hirnareale zu Kommunikationsfehlern kommt.
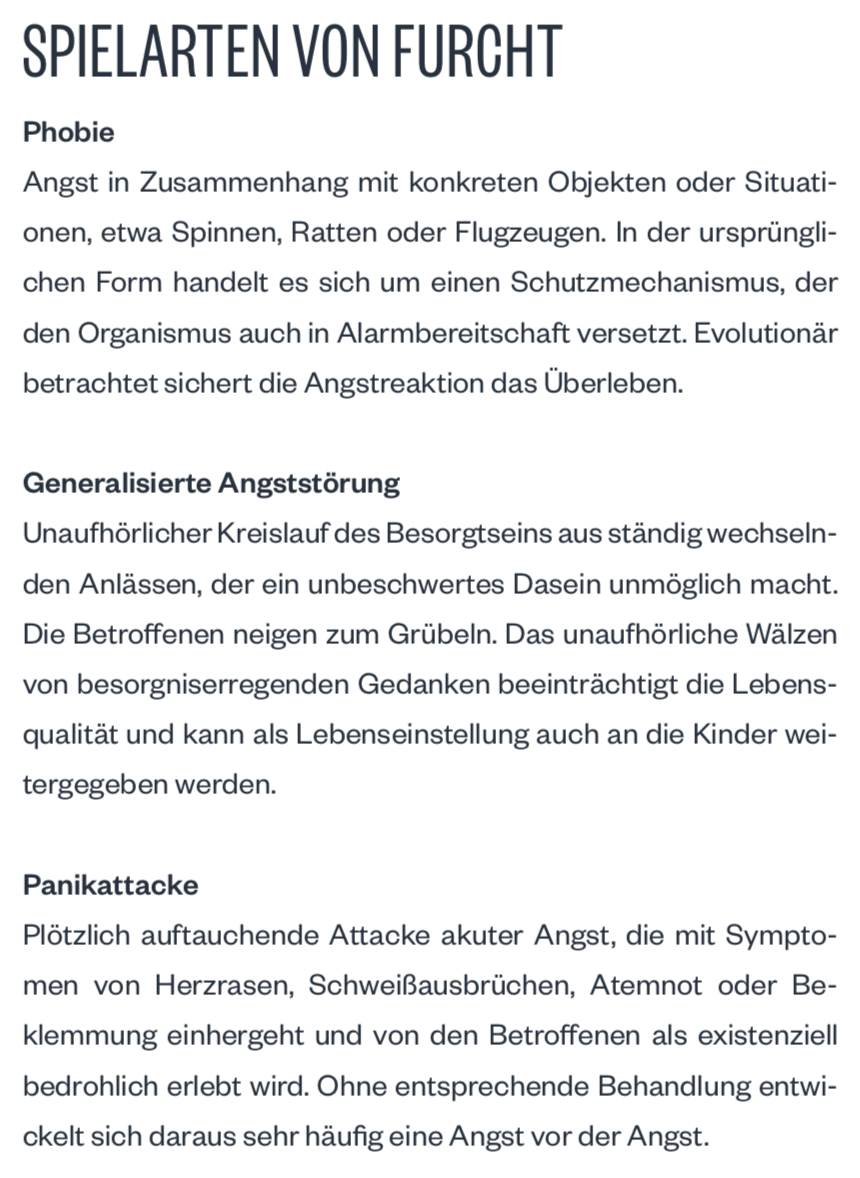
„Panikattacken sind eine Überflutung von starken Gefühlen“, sagt der Linzer Psychotherapeut Hans Morschitzky in seinem Buch mit dem Titel ‚Angststörungen‘ und vergleicht sie mit einem ‚Gefühlsstau‘, der den Betroffenen in den wenigsten Fällen bewusst ist. Es sei so, als würde man mit angezogener Handbremse Vollgas geben. Eine Wut im Bauch, ein Gefühl von Ohnmacht, die Angst, verlassen zu werden: All das könne sich in Form einer Panikattacke äußern. Martina H. empfindet, wenn ‚es ihr in der Öffentlichkeit passiert‘, wie sie sagt, auch Scham. Ihr Kontrollverlust ist ihr peinlich den anderen gegenüber. „Ich wollte nicht, dass jemand merkt, wie es mir geht, ich habe es noch auf die Toilette geschafft und bin erst rausgekommen, als es mir wieder besser ging.“ Langfristig, so Morschitzky, bestehe die Gefahr, dass sich Menschen mit Angststörungen aus dem sozialen Leben immer mehr zurückziehen, sich einigeln, weil sie sich zu Hause am sichersten fühlen. Doch gerade diese Isolation gilt es zu vermeiden.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 109: „Angst überwinden"
Jetzt aber die gute Nachricht: Angsterkrankungen sind sehr gut behandelbar. Das ist auch mit Zahlen belegt. Die Erfolgsquote bei Phobien liegt bei 90 Prozent, wenn sich Betroffene auf eine Verhaltenstherapie einlassen und sich mit angstbesetzten Objekten und Situationen konfrontieren. Aber auch bei Panikattacken und generalisierten Angststörungen können Betroffene mit der Hilfe von Psychotherapeuten viel erreichen – zwischen 60 und 70 Prozent der Betroffenen werden ihre Ängste langfristig wieder los.
Dabei ist es nicht nur die Psychotherapie, sondern ein Bündel an Maßnahmen, die in Summe das Leben der Patientinnen und Patienten verbessern. Zum einen geht es darum, sich auch in Extremsituationen verstehen zu lernen, also zu wissen, was im Körper gerade passiert. Es gibt eine Reihe von Techniken für Paniksituationen, die sich gut trainieren lassen. „Wir können mehr sein als unsere Angst“, ist ein Satz aus Steve Haines’ wunderbarer Graphic Novel ‚Angst ist ziemlich strange‘, die sämtliche Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen in klugen Bildern und kurzen Texten zusammenfasst. Dort findet man auch Ideen, wie das ‚Reframing‘, also das ‚Sich-Neu-Programmieren‘ aussehen könnte. Ein Teil davon ist die Achtsamkeitspraxis mit mentalen und körperlichen Übungen. „Ehrfurcht pflegen, weil es das Nervensystem ausbremst“, schreibt Haines. Der physische Körper und die Gedanken sind viel stärker miteinander gekoppelt, als Menschen wie Martina es für möglich halten. Was damit gemeint ist: „Die Verbindung zum eigenen Körper, zum Selbst, zu den anderen, zur Natur und zu allem Rätselhaften pflegen“, so Haines. Ziel ist, sie in Einklang zu bringen. Und noch eine gute Nachricht: Das Gehirn bleibt zeit seines Lebens wandelbar, falsche Schaltkreise lassen sich überschreiben – deshalb kann man die Angst mit den eigenen Gedanken auch wieder löschen.










