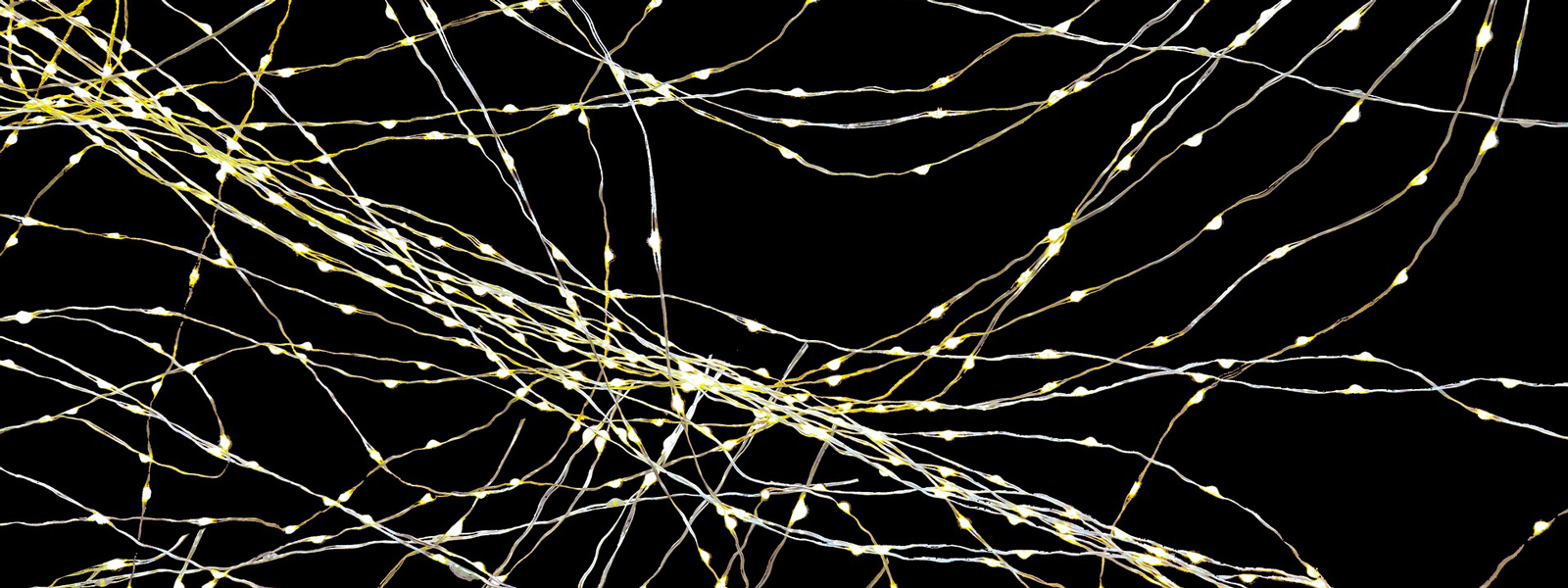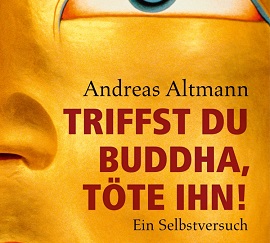Wie uns Ängste helfen, das Leben zu meistern, und uns auch glücklich machen können.
Nacht. Sie gehen eine menschenleere, schlecht beleuchtete Straße entlang. Dann sehen Sie in einigen Metern Entfernung eine dunkle Gestalt an einer Hauswand lehnen. Trotz der späten Stunde sind Sie plötzlich hellwach. Ihre Hypophyse, die erbsengroße Hirnanhangsdrüse tief in Ihrem Gehirn, produziert sofort Steuerungshormone, die wiederum die Nebenniere anregen, mehr Adrenalin auszustoßen. Daraufhin erweitern sich Ihre Pupillen, die Seh- und Hörnerven werden empfindlicher und Ihr Blutdruck wie auch Pulsschlag steigen. Die Lungenbläschen weiten sich, Sie atmen schneller. Körperreserven wie Glykogen, Fette und Eiweiße werden in ihre Bestandteile zerlegt, die Muskeln spannen sich an, was sich als leichtes Zittern bemerkbar macht. Aber es steht Ihnen jetzt mehr Energie zur Verfügung. Auch Ihre Körpertemperatur ist leicht gestiegen, Sie fangen zu schwitzen an.
Die Verdauung des Essens, das Sie gerade in einem Restaurant zu sich genommen haben, wird gestoppt und falls Sie noch erotischen Fantasien nachgehangen haben, so sind diese ebenfalls verschwunden. Die oberflächlichen Blutgefäße haben sich verengt, Ihre Gesichtsfarbe ist blasser geworden, was von Außenstehenden als Erbleichen wahrgenommen wird.
Diese hier ausführlich beschriebenen Vorgänge spielen sich in Bruchteilen einer Sekunde ab, ohne dass Ihr langsamer Vorderhirnlappen, der für Ihr Bewusstsein zuständig ist, eingeschaltet wurde. Ein Gefühl hat sich in Ihnen ausgebreitet: Angst. Dieses hat Sie aber gut vorbereitet, um sich für zwei Möglichkeiten zu entscheiden: kämpfen oder weglaufen. In jedem Fall verfügen Sie jetzt über die dafür notwendigen Kraftreserven.
Sollte sich die Begegnung mit dem unbekannten Mann auf der Straße tatsächlich als Bedrohung herausstellen, werden Sie sich in den meisten Fällen für die Flucht entscheiden. Die benötigte Energie dafür ist mit wenigen hundert Kilokalorien geringer als eine aggressive Auseinandersetzung. Und vor allem eine sicherere Variante, denn eine Attacke kann folgenschwere Verletzungen nach sich ziehen. Daher ist unsere ‚Alarmanlage‘, die uns Angst empfinden lässt, sehr empfindlich eingestellt. Das Prinzip gleicht dem eines Rauchdetektors, der sinnvollerweise so sensibel reagiert, damit er auch in Situationen aktiv wird, in denen es keine akute Brandgefahr gibt. Auch bei uns erweist sich manche Angstsituation nachträglich als unbegründet.
Unabhängig davon, ob sich Säugetiere wie auch Menschen in bedrohlichen Situationen für Angriff oder Flucht entscheiden, in jedem Fall brauchen sie Energie. Entkam man dem Angreifer oder besiegte man diesen, erst dann spürte man die Anstrengung. Wir empfinden im Nachhinein aber auch Gefühle der Erleichterung und Zufriedenheit. Es gibt zudem das Phänomen der Angstlust, die auch als ‚Thrill-seeking‘ in der Psychologie bekannt ist.
Aus Sicht der Evolutionsbiologie ist Angst eine lebenswichtige Funktion: Sie schärft unsere Sinne und aktiviert zusätzliche – manchmal sogar quasi ‚übermenschliche‘ – Körperkräfte. Die hier beschriebenen körperlichen Symptome der Angst sind daher ganz normale und notwendige physische Reaktionen, die uns helfen, Gefahren zu bewältigen. Der Begriff der Kampf-oder-Flucht-Reaktion (englisch: fight-or-flight response) wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom US-amerikanischen Physiologen Walter Cannon eingeführt, um die komplexen Rückkopplungsmechanismen unseres Nerven- und Hormonsystems zu beschreiben.
Mittlerweile wurde dieses Steuerungsmodell vom britischen Psychologen Jeffrey Alan Gray zur Formel ‚Freeze, flight, fight, or fright‘ erweitert. In der Freeze-Phase (englisch: einfrieren) ist man sprichwörtlich ‚starr vor Angst‘. Als Grund für diese Reaktion führte Gray die damit verbundene Chance eines Steinzeitmenschen an, vom Raubtier übersehen zu werden. Die weitere Reaktionsabfolge drehte er um, da zu flüchten eher unserem Verhaltensmuster entspricht. Wenn weder Flucht noch Kampf eine mögliche Option ist, dann kann ‚fright‘, also Furcht, eine weitere Option sein. Hier soll es im Unterschied zur Freeze-Phase zu einer völligen Muskellähmung kommen, wobei das Opfer hofft, dass der Aggressor sein Interesse an einem ‚leblosen‘ Gegenüber verliert.

Andere Studien vermuten wiederum Unterschiede in der Angstreaktion von Mann und Frau. Die Kampf-oder-Flucht-Reaktion soll bei Frauen schwächer ausgeprägt sein, stattdessen würden diese in Gefahrensituationen lieber den Kontakt zu schutzbietenden Gruppen suchen. Dies wurde in der Fachliteratur als ‚Tend-and-befriend‘ beschrieben, den Nachwuchs beschützen (tend) und Freundschaft anbieten (befriend). Hier verlassen wir aber den Bereich der datengestützten Forschung und betreten das gefährliche Feld spekulativer Behauptungen, die möglicherweise nur aus einem bestimmten gesellschaftspolitischen Blickpunkt heraus entstanden sind.
Traditionell befasst sich die Humanwissenschaft, allen voran die Psychologie, mit dem Phänomen der Angst und unterscheidet dabei zwischen der situationsbedingt entstehenden Emotion Angst und der einer Person immanenten Eigenschaft Ängstlichkeit. Andere, wie beispielsweise der Experimentalpsychologe Siegbert Warwitz, sprechen sogar von einem ganzen ‚Feld der Angstgefühle‘, zu dem er Erscheinungsformen wie Scheu, Schüchternheit, Bangigkeit, Zaghaftigkeit, Zwangsverhalten und Phobien zählt.
Letztere sind eine Form der Angststörung, bei der Ängste auf konkrete Dinge gerichtet oder mit bestimmten auslösenden Situationen verbunden sind. Die Angst vor Insekten oder Spinnen ist eine sehr weit verbreitete Phobie, für die unterschiedliche Erklärungen kursieren.
Manche Forscher vermuten eine evolutionäre Anpassung, die unsere Vorfahren durch Selektion erworben haben. Da die Gefahr, durch diese Tiergruppe vorzeitig zu sterben, im Vergleich zu Begegnungen mit Säbelzahntigern, Höhlenbären und Mammuts gering ist, erscheint diese Begründung nicht plausibel.
Eine andere Theorie postuliert, dass Phobien umso stärker und häufiger sind, je mehr sich ein Lebewesen oder ein Gegenstand vom Menschen unterscheidet. Auch diese Vermutung erscheint lückenhaft. Weder ist eine Angst vor Steinen, die seit Jahrtausenden als Waffen verwendet wurden, bekannt, noch wurde je eine tatsächliche Angststörung gegenüber defekten Elektrokabeln festgestellt.
Viel wahrscheinlicher scheint die Erklärung, dass jede Art von Angst gelernt, dadurch aber auch wieder verlernt werden kann. Gefahrensignale im Gedächtnis abzuspeichern hat eindeutig Selektionsvorteile. Angst ist in diesem Modell eine erlernte Verbindung eines auslösenden Reizes, etwa zwischen den sichtbaren Zähnen eines Tieres und den weiteren Folgen (Bisswunde). Auf diese Weise erlernt man Ängste entweder durch eigene Erfahrung, sprich Konditionierung, durch Beobachtung seiner sozialen Umgebung – die eigenen Eltern reagieren panisch angesichts einer Spinne oder durch Anweisung – oder Symbole, ein Blitz bedeutet Stromschlag. Da die Angst vor Spinnen nur in bestimmten Regionen der Welt verbreitet und bei Naturvölkern unbekannt ist, spricht sehr viel dafür, dass dies eine erlernte Verhaltensweise ist.
Menschen meiden aber nicht nur das, wovor sie sich fürchten, sondern sie suchen es manchmal auch ganz aktiv. Denn Angst ist nicht nur eine negative Gefühlsregung. Angst kann auch als lustvolle Erfahrung gesucht und erlebt werden, etwa in Form des Thrills. Im Alltagsdeutsch wird der Begriff häufig mit dem eingängigen Wort ‚Nervenkitzel‘ beschrieben und drückt damit aus, dass es sich dabei um ein stark aufwühlendes Gefühlserlebnis handelt, das aus dem Gegensatz der Gefühle entsteht, wobei die Erlösung aus der qualvollen Phase als befreiend erlebt wird. Angstgefühle helfen uns, gefährliche Situationen zu überleben, und ihre Überwindung löst Glücksgefühle in uns aus. Wir sollten uns vor Ängsten also nicht fürchten.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.
Illustrationen © Francesco Ciccolella
Header © 2018 exgenio