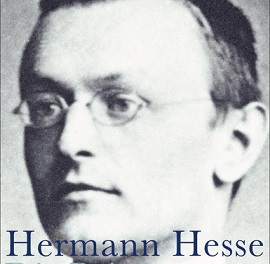Die spirituelle Suche wird meist als Weg zu sich selbst oder als Weg zu Gott gesehen. Als ich mich auf den ‚Weg' machte, war mir das zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar. Erst im Rückblick ist es erkennbar, wann ich die ersten Schritte gegangen bin.
Joshu fragte Nansen: „Was ist der Weg?"
„Was ist der Weg?" Das war die Frage Tausender Zen-Mönche im Laufe der Geschichte. „Was ist der Weg?", lautet die Frage vieler Suchender auch heute.
Vorgeschichte
Ich saß in einer großen Runde zu Beginn eines Seminars, das gewöhnlich in die Ecke ‚Esoterik' gestellt wird. Ein Freund hatte es mir ans Herz gelegt. Mit Esoterik hatte ich nichts am Hut, zu meditieren hatte ich jedoch schon in meinen Zwanzigern angefangen. Nur nahm es in meinem Leben zwischen Kindern, Karriere und Katheder keinen zentralen Stellenwert ein. Ich hatte sogar einen Meditationslehrer, aber es war eine lose, fast beiläufige Beziehung, wir sahen einander nicht oft. Meditation war für mich anfangs ein neugieriges Ausprobieren ohne bestimmte Richtung, eine Erkundung, was es so gibt.
Sich auf den Weg machen heißt, eine Entscheidung für sein Leben zu treffen.
Neugierde hatte mich auch bewogen, dieses Seminar in den Schweizer Bergen zu buchen. Es wurde von einer Schamanin, die bei den Aborigines Australiens gelebt und gelernt hatte, geleitet. Die Runde schaute sie erwartungsvoll an. Zur Begrüßung sagte sie jedem, wie lange er oder sie bereits auf dem ‚Weg' ist. Die Reihe war nun an mir. „Du bist seit sechs Jahren auf dem Weg", sagte sie mir. „Was? Ich meditiere ja schon viel länger", dachte ich und war innerlich ein wenig beleidigt.
Der erste Schritt: Die Entscheidung
Doch sie hatte recht. Sich auf den Weg machen bedeutet nicht, hier einen Meditations-Schnupperkurs zu buchen und dort ein Schwitzhüttenseminar zu absolvieren. Sich auf den Weg machen heißt, eine Entscheidung für sein Leben zu treffen. Sechs Jahre davor hatte ich die Entscheidung getroffen, meinen Beruf und eine sichere Stelle aufzugeben. Bis zu meinem 40. Lebensjahr bin ich einen geradlinigen, vorgezeichneten Weg gegangen – Schule, Studium, Karriere. Meine Eltern waren stolz auf mich. Und ich auch ein bisschen.
Der vorgefertigte, geplante Weg passte nicht mehr.
Doch plötzlich geriet zentimeterweise meine Welt aus den Fugen. Der vorgefertigte, geplante Weg passte nicht mehr. Innere Kämpfe und Schmerzen ließen mich erkennen, dass ich meine eigene Richtung suchen musste – entgegen der Meinung meines Umfelds, das diese radikale Wende, den vorgegebenen Pfad zu verlassen und mein Leben in die eigene Hand zu nehmen, als absurd und lebensbedrohend abkanzelte. Trotzdem kündigte ich die ‚Lebensanstellung' und sprang gewissermaßen von der Kante in den Abgrund. Es war, als ob meine Identität, die ich mir jahrzehntelang aufgebaut hatte, in tausend Stücke geborsten wäre. Danach begann eine Selbsterkundung mit Selbsterfahrungsgruppen, Seminaren und einer tiefen Suche nach dem Sinn. Rückblickend hatte mein Weg erst damals begonnen und nicht, als ich die Meditationspraxis angefangen hatte.
Der zweite Schritt: Es gibt einen Weg
Wenige Monate später nahm ich an meinem ersten Zen-Seminar (Sesshin) teil. Es war eine eher improvisierte Geschichte. Ein Zen-Übungsraum war in einem Seminarraum eines Hotels notdürftig mit Pinnwänden abgetrennt worden. Es waren wenige Teilnehmer und die waren – rückblickend gesehen – nicht sehr motiviert. Ich lernte, wie man den Übungsraum betritt, wie man sich verbeugt und wie man auf der Matte sitzt und den Atem beobachtet. Nach der ersten Meditationseinheit trat ein tiefes Gefühl von ‚Ich bin angekommen' in mir ein. Die Suche nach allen Richtungen hin war vorbei, der Zen-Weg hatte begonnen. Am Anfang gab es Perioden, in denen ich auf das Meditieren vergaß, denn der Alltag mit seinen Dringlichkeiten war stärker als die Sehnsucht nach der Meditationsecke. Nach und nach wurde ich jedoch eine fleißige Zen-Überin, meditierte täglich zu Hause und ging zu allen Sesshins meines Lehrers, die es gab. In meinem ersten Zen-Jahrzehnt werden es wohl mehr als 50 gewesen sein. Es war der Ruf der Sehnsucht nach der Versenkung und einem anderen Sein.
Nach der ersten Meditationseinheit trat ein tiefes Gefühl von ‚Ich bin angekommen' in mir ein.
Mein damaliger Lehrer entwickelte – wohl aus pädagogischen Gründen – ein Stufensystem, so dass ich meinte, es gäbe eine Stufe nach der anderen zu erklimmen. Hier hatte ich einen Weg mit fixen Stationen. Die Gewissheit, dass es einen Weg gibt, den Tausende andere Menschen vor mir gegangen sind, gab mir das Vertrauen, um weiterzuschreiten. Ich meditierte viel, ich las viel und freute mich, dass es ‚voranging'. Joshu fragte: „Soll ich mich auf die Suche danach (nach dem Weg) machen?" Darauf Nansen: „Je mehr du dich bemühst, ihn zu finden, desto mehr entzieht er sich dir." Je mehr ich mich mit Zen beschäftigte, Bücher las und fleißig meditierte, desto größer wurde mein Ehrgeiz. Ich war stolz darauf, Vorträge über Zen zu halten und Aufgaben innerhalb der Organisation (Sangha) übertragen zu bekommen. Ich war quasi bei allen Sesshins die Leiterin (Jikijitsu) und spielte auch in der Ausbildung der Zen-Schüler eine große Rolle. Gleichzeitig schritt ich voran auf meinem Zen-Weg, übte weiterhin viel und wartete auf die große Erfahrung. Ich bemühte mich, den Weg zu erkennen, doch er entzog sich mir immer wieder.

Der dritte Schritt: Es gibt keinen Weg
Eine Einsicht über den Weg brachte ein Winter-Seminar (Rohatsu-Sesshin), bei dem ich Leiterin war. Es war ein kalter Winter in Norddeutschland und es schneite viel. Nach der ersten Morgenmeditation um vier Uhr in der Früh gingen wir in die winterliche Stille hinaus. Gehmeditation in der Stille der Nacht ist etwas Besonderes. Einer ging hinter dem anderen und vorneweg stapfte ich. Eine lange Schlange von 40 Personen verließ sich darauf, dass ich ihnen den Weg zeigte. In den wenigen Stunden, in denen wir geschlafen hatten, hatte es mindestens 40 Zentimeter geschneit. Es herrschten gefühlte 20 Grad unter null und wir mussten die Beine bei jedem Schritt hochheben, um im tiefen Schnee voranzukommen. Die ersten 100 Meter durch den hohen Schnee waren mühsam, jedoch konnte ich mich im Lampenschein des Hauses halbwegs orientieren. Dann trat ich aus dem Lichtschein in die Finsternis. Ich konnte nicht stehen bleiben, um den Weg zu suchen, da sonst 40 Personen hinter mir durcheinander gekommen wären. Der frisch gefallene Schnee bedeckte eine große Fläche. Nur sehr schemenhaft erkannte ich als Schatten im Nebel der Finsternis die Alleebäume, die links und rechts den unsichtbaren Weg säumten. Sie konnten kaum als Anhaltspunkte für den Weg dienen. Es half nichts, ich musste ohne Zögern einen Schritt nach dem anderen in das Nichts der Finsternis setzen und mutig im gleichen Tempo voranschreiten. In dem Moment, als ich vom Lichtschein in die Finsternis hineinstapfte und mich der Finsternis überließ, geschah etwas.
Die Suche nach allen Richtungen hin war vorbei, der Zen-Weg hatte begonnen.
„Wie kann ich aber den Weg erkennen, wenn ich ihn nicht suche?", beharrte Joshu. Der Weg wird beschreitbar, wenn man trotz aller Bemühungen das Suchen aufgibt. Der Weg in die Finsternis war ein Weiterschreiten und gleichzeitig ein Sich-Ergeben in die Weite des Schnees. Mein Zen-Weg ist: Mit 100%iger Energie voran und trotzdem nichts erreichen wollen. Der erste Teil ist für mich normal, der zweite Teil, nichts zu wollen, war immer wieder schwierig. „Höre auf, nach etwas zu streben", auf Japanisch ‚motomenai', sagte mir mein späterer Zen-Lehrer immer wieder. Und so bin ich noch lange nicht dort, aber um einen Nicht-Zentimeter dem Nicht-Streben näher gekommen. „Der alltägliche Geist ist der Weg", sagt Nansen Zenji. Es gibt keinen Weg, der zu suchen wäre. Das alltägliche Leben ist der Weg. Und der Weg, das zu begreifen, ist, auf der Matte zu sitzen, in der Bemühung zu sein und doch nach nichts zu streben. Bis – ja, bis man erkannt hat, dass der Weg kein Weg und doch ein Weg ist. Dann beginnt der Weg sich im Alltag zu zeigen.
Der Weg wird beschreitbar, wenn man trotz aller Bemühungen das Suchen aufgibt.
Joshu fragte Nansen: „Was ist der Weg?" Nansen antwortete: „Der alltägliche Geist ist der Weg." Joshu fragte: „Soll ich mich auf die Suche danach machen?" Darauf Nansen: „Je mehr du dich bemühst, ihn zu finden, desto mehr entzieht er sich dir." „Wie kann ich aber den Weg erkennen, wenn ich ihn nicht suche?", beharrte Joshu. Nansen sagte: „Der Weg gehört nicht der Ebene des Wissens oder des Nicht-Wissens an. Wissen ist Illusion, Nicht-Wissen ist gar nichts. Wenn du wahrhaftig den Weg des Nicht-Zweifels erreichst, dann wirst du sehen, dass er grenzenlos ist und weit wie das Weltall. Wie kann man da noch diskutieren, was richtig und falsch ist?" Bei diesen Worten kam Joshu zu einer tiefen Einsicht.
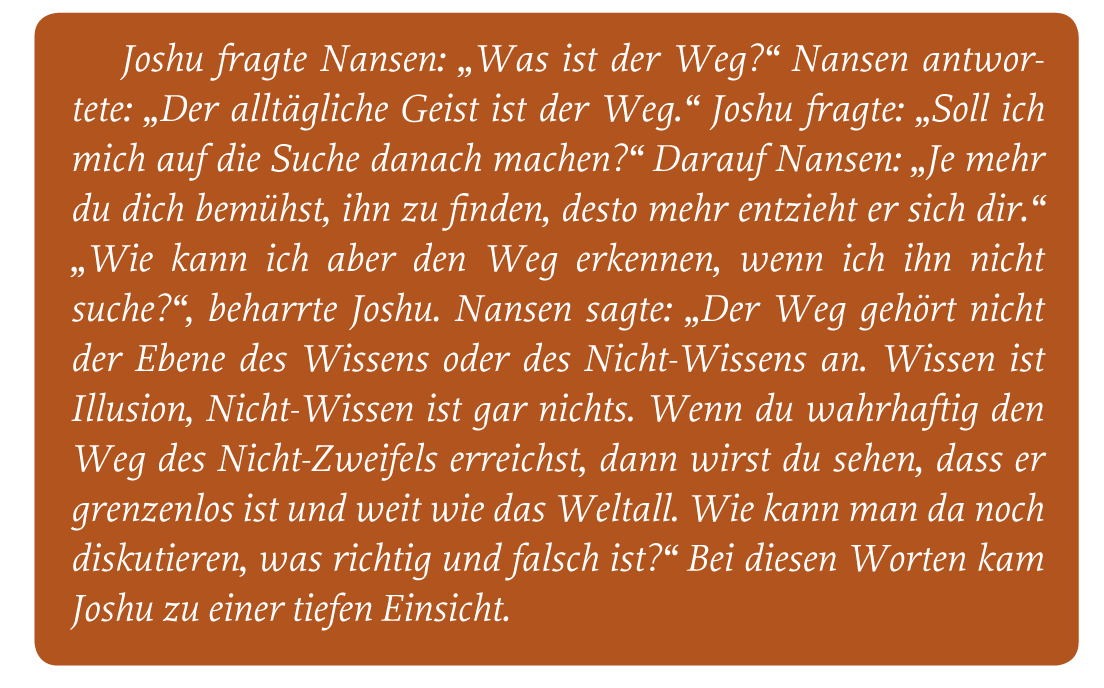
Der Begriff ‚Weg': Von Buddha-Dharma zu Tao und weiter zu Do
Bei der Übersetzung buddhistischer Begriffe vom Sanskrit ins Chinesische musste man neue Wörter finden. Manche Wörter wurden lautmalerisch ‚übersetzt', so wurde Bodhisattva zu Bodaisatta. Kulturspezifische Begriffe, die in der philosophisch-metaphysisch geprägten Kultur Indiens wurzelten, verlangten nach einem Pendant in der pragmatisch geprägten Kultur der Chinesen. Eines davon ist Buddha-Dharma. Das Wort Dharma beinhaltete bereits in Indien verschiedene Aspekte wie das Gesetz von Ursache und Wirkung, die Lehre Buddhas, die letzte Wahrheit und andere. Im Übergang zur neuen Kultur wurde Buddha-Dharma mit Tao, ‚Weg', übersetzt, ein Begriff, der in China schon eine jahrhundertealte Geschichte hatte. Buddha-Dharma wurde zum Weg, der unsichtbare Weg zur universellen Wahrheit. Indem der Begriff ‚Weg' so viele Aspekte und Bilder in sich vereint, ist er in seiner Vieldeutigkeit geeignet, in den Lücken und Spalten zwischen den Bedeutungen die Wahrheit durchscheinen zu lassen.
Das alltägliche Leben ist der Weg.
Auf der Reise nach Japan wurde Tao japanisch ausgesprochen, nämlich Do. Do drückt aus, dass der Weg zur universellen Wahrheit im Tun ausgedrückt wird. Nun ist es zwar ein Tun im alltäglichen Geist, die Do-Wege sind Künste, die man durch immerwährende Wiederholung und Disziplinierung zu einer hohen Kunst verfeinert, zum Beispiel im ‚Weg der Blumensteckkunst' (Kado oder Ikebana) oder im ‚Weg der Kalligraphie' (Shodo).
Dabei spielen die Haltung und der Atem wie im Zazen, der sitzenden Zen-Meditation, eine zentrale Rolle. In aufrechter Haltung und regelmäßig atmend reibt der Schüler den Tuschestein, um Tusche herzustellen. Der Pinselstrich folgt dem Atem und so manifestiert er im alltäglichen Geist den Weg. Zur Erörterung des Unterschieds zwischen dem ‚Weg' im Zen und dem Tao im Taoismus siehe: Hisaki Hashi: ‚Angelpunkte und Unterschiede von Zen-Buddhismus und Taoismus' in: Hashi, Gabriel und Haselbach: Zen und Tao. Beiträge zum asiatischen Denken, Wien, Passagen Verlag 2007.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.