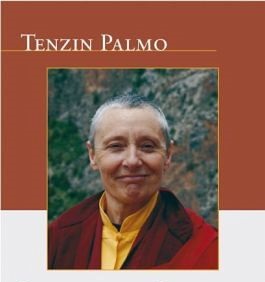Theorie ohne Praxis ist nutzlos. Das Wichtigste im Zen ist also Zazen – einfach in Ruhe sitzen. Dabei werden Geist und Herz beobachtet, erkannt und trainiert.
Menschen sitzen schweigend in einer leeren Halle. Sitzen, sonst nichts. Präsenz in Gegenwärtigkeit. Ein Garten mit einem Arrangement großer Findlinge und sorgsam geharkter Kieselsteine. Darin arbeitet ein Mönch, ganz dem Moment der Arbeit gewidmet. Nadelbäume im Nebel auf einer japanischen Tuschezeichnung. Wenige Striche deuten die Baumkonturen an, der Großteil des Bildes bleibt weiße, leere Fläche.
Einfachheit gilt als die Ästhetik des Zen, das Schweigen als seine Sprache. Das Schweigen – und gelegentliche Ausbrüche eines anarchistischen Lachens, wenn der Zen-Meister Konventionen des Denkens und der Etikette über Bord wirft.
Das Wort Zen hat eine lange Geschichte. Letztlich ist es gleichbedeutend mit Meditation – das Bewusstsein sinkt in seinen ursprünglichen Grund. Zen ist der weglose Weg, das torlose Tor. In seiner Mitte liegt die Erfahrung und gleichzeitig gibt es keine Mitte im Zen, kein Innen und Außen.
Wenn von Zen die Rede ist, lassen sich zwei Ebenen unterscheiden. Die metaphorische – Zen als Herz der Meditation, als Erfahrungsraum jenseits von Sprache, Ort und Zeit. Eine zweite Ebene ist die des historisch-gewachsenen Zen. Hier finden sich Zen-Schulen mit ihren Übertragungslinien, ihren Traditionen und kulturellen Prägungen.
Entstanden ist Zen als Ch'an-Buddhismus im fünften Jahrhundert in China, aus vielen regionalen Gruppierungen, die in Bescheidenheit lebten und intensiv meditierten. Schriftlich fixierten Weisheiten stand der Zen-Buddhismus von Anfang an skeptisch gegenüber. Gleichwohl kennt er ethische Grundregeln und es hat sich eine reiche Zen-Literatur entwickelt.
Philosophisch ist der Zen-Buddhismus eng verwandt mit anderen Schulen des Buddhismus, die in China mit Elementen des Daoismus und Konfuzianismus verschmolzen. Somit gehört Zen zum großen Zweig des Mahayana-Buddhismus, allerdings mit ‚chinesischer Grundierung': Konkret statt abstrakt. Einfach statt kompliziert. Essenziell statt verästelt. Einem durchaus positiv bewerteten Diesseits zugetan statt theoretischer Erörterungen oder intellektuellem Rückzug von der Welt. Vor allem aber betont der Zen-Buddhismus in besonderer Weise die unmittelbare, persönliche Erfahrung – daher rühren sein charakteristischer Lehrstil und sein künstlerischer Ausdruck.
Im Laufe der Zeit wanderte der Zen-Buddhismus von China nach Korea, Japan und Vietnam. Es sind landestypische Ausprägungen entstanden, Zen-Schulen und -Tempel, Übertragungslinien von einem zum nächsten Patriarchen. Zen-Lehrer und -Praktizierende haben sich mit den Mächtigen ihrer Zeit verbündet, andere setzten Reformen durch, wieder andere zogen sich als Rebellen aus den Institutionen zurück und suchten Freiheit und Befreiung in der Abgeschiedenheit der Natur.
Im 20. Jahrhundert wanderte der Zen-Buddhismus in den Westen und erfährt nun auch hier Traditionsweitergabe wie Anpassungsvorgänge. Vor allem der japanische Zen ist im Westen vertreten. Mit Thich Nhat Hanh lebt auch ein bedeutender Repräsentant des vietnamesischen Zen im Westen, ebenso sind hochgeschätzte Meisterinnen und Meister aus Korea vertreten.
Die Hauptlehrmethode aller Zen-Schulen ist das Zazen – die Sitzmeditation in Stille. Großer Wert wird dabei auf eine aufrechte, ruhige Körperhaltung gelegt. Als Hilfsmittel dient das Sitzkissen mit einer darunterliegenden Matte.
Zazen kann im vollen oder halben Lotossitz ausgeübt werden, im Fersensitz oder auch im Burmesischen Sitz, einem abgewandelten Schneidersitz, bei dem die Knie den Boden berühren. Wer in keiner dieser Haltungen meditieren kann, darf mitunter auch aufrecht auf einem Stuhl Platz nehmen.
In längeren Meditationen können körperliche Schmerzen oder ungewöhnliche Gefühle auftreten. Wie bei jeder Meditation geht es darum, das Auf- und Abtauchen solcher Empfindungen zur Kenntnis zu nehmen, ohne sich darin zu verstricken.
In der Tradition des Rinzai-Zen – neben dem Sōtō-Zen eine der zwei großen Richtungen in Japan – gibt es auch die Arbeit mit traditionellen Koans. Das sind paradoxe Anekdoten, Fragen oder kurze Dialoge. Sie sollen das begriffliche Denken aufsprengen, weil es auf logisch-intellektueller Ebene keinen sinnvollen Umgang mit dem Koan gibt.
Auch wenn die Zazen-Praxis die achtsame Betrachtung des Atems und der Gefühls- und Denkvorgänge kennt, wird dabei doch keine ausdifferenzierte Betrachtung körperlicher und geistiger Prozesse geübt, wie etwa in der Vipassana-Meditation des Theravada-Buddhismus. Stattdessen geht es darum, die eigene Körperlichkeit mitsamt Sinneswahrnehmungen und gedanklichen Prozessen in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen und ansonsten einfach zu sitzen – ohne ein darüber hinausgehendes Ziel oder Lernkonzept.

Dabei kann es geschehen, dass das Bewusstsein sich – ohne besondere Fokussierung, wach und konzentriert – für den gegenwärtigen Moment und die Ganzheit aller Phänomene öffnet. Subtile Ebenen des Gewahrseins können erfahren werden oder auch der plötzliche Durchbruch eines völlig anderen Erlebens. Eine solche mystisch-spirituelle Erfahrung wird im Zen Kenshō oder Satori genannt: Die ‚Wirklichkeit, wie sie ist' bricht zum Praktizierenden durch und er oder sie erkennt sich als Buddha-Natur. Die Unterscheidung von diesem hier und jenem dort, das Auseinanderdividieren der Wirklichkeit in einzelne Personen, Objekte, Begriffe verliert ihren Sinn.
Neben dem Zazen gehören weitere Methoden zur Praxis: Gehmeditation, Einzelgespräche mit der Lehrerin oder dem Lehrer, Vorträge, Rezitationen und tägliche Stunden konzentrierter Arbeit. Besonders intensiv wird in mehrtägigen Klausuren (Sesshin, Retreat) praktiziert.
In den deutschsprachigen Ländern gibt es heute viele Möglichkeiten, Zen zu üben. Es sind Schulen vertreten, die sich eng an die Tradition asiatischer Haupttempel anlehnen. Es gibt Zen-Meditationskurse in Volkshochschulen und sogar in christlichen Kirchen, denn auch das gehört zur Geschichte des Zen: ein lebendiges und gewidmetes Interesse vieler Christinnen und Christen am stillen Sitzen in offener Präsenz.
Gute Gründe sprechen dafür, sich einer Gruppe mit Lehrerin oder Lehrer anzuschließen. Eine gewidmete Zen-Praxis erfordert Geduld und Beharrlichkeit. Sie ruft unweigerlich Gedanken und Gefühle hervor, mit denen ein Umgang gefunden werden muss. Hier ist das Vorbild erfahrener Praktizierender von großem Wert.
Für eine gemeinschaftliche Praxis sprechen aber auch Gründe, die eng mit der buddhistischen Lehre zusammenhängen: Nicht intellektuell, sondern ‚I-Shin, Den-Shin', ‚von Herzgeist zu Herzgeist' werde der Dharma übertragen, heißt es im Zen und anderen japanisch-buddhistischen Schulen. Ein Meister, eine Meisterin, die große innere Freiheit erlangt haben und sich als lebendige Wegweiser anbieten, sind durch kein kluges Buch zu ersetzen.
Gleichwohl praktizieren viele Menschen Zazen allein zu Hause und machen damit wertvolle Erfahrungen.
SUSANNE BILLIG
Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.