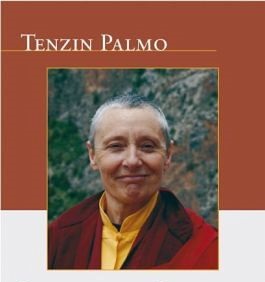Kürzlich habe ich wieder einmal einen Brief geschrieben, also getippt. Und dabei dachte ich mir, dass wir das alle viel zu selten tun. Dabei ist das eine so angenehme Art der Kommunikation.
Ich war immer schon eine leidenschaftliche Brief- und Kartenschreiberin. Zu meinem 50. hat mir eine Freundin die Post zurückgeschenkt, die sie im Laufe der Jahrzehnte von mir bekommen hat. Und auch meine Mutter hat mir kürzlich eine Schatulle mit alten Weihnachtskarten und -briefen überreicht, die meine Oma aufgehoben hatte. Manche sind mit der Hand geschrieben, die meisten aber getippt, weil meine Handschrift schon lange nur mehr ausgewählte Personen lesen können. Und um die Freude über Post zu maximieren, bin ich irgendwann einmal davon abgekommen, Handschriftliches zu erstellen. Einmal hatte ich auch eine App installiert, wo man die eigenen Fotos als Postkarten verschicken kann, denn stellenweise kann man noch nicht einmal mehr Postkarten kaufen.
Heute Morgen habe ich einen Podcast zum Thema Briefeschreiben gehört, und darin war tatsächlich die Rede davon, dass es Überlegungen gab und gibt, die Schreibschrift in den Schulen abzuschaffen. Finnland hat es beispielsweise schon 2016 getan, Großbuchstaben müssen es dort richten. Was bedeutet, dass ich eigentlich nach Finnland auswandern müsste. Ich schreibe nämlich schon seit Jahrzehnten mit Großbuchstaben. Die Erfahrung, dass das leichter lesbar wäre, hat sich nicht eingestellt – eher das Gegenteil. Das mag aber damit zusammenhängen, dass meine Großbuchstaben zusammenhängen und deshalb auch schon einmal die Frage auftauchte, welche Sprache das sei. Ich kann anders, wenn ich muss – von der Fähigkeit mancher Postausträger, meine Zeilen entziffern zu können, bin ich wenig überzeugt. Deshalb ist die Adresse meistens gut leserlich, der Absender wieder wie gehabt. Und wenn ich besonders viel Zeit habe, schreibe ich eine Ansichtskarte in Schulschrift – da komme ich dann schon ins Schwitzen, weil mich das Langsame daran so aufregt.
Handschrift sei Seelenschrift, lese ich im Internet. Deshalb habe ich mich auch immer sehr gesehen gefühlt, wenn jemand meine Hieroglyphen entziffern konnte. Kürzlich wurden sie als kryptisch bezeichnet, und das trifft mich wohl am ehesten. Zumindest was manche Menschen angeht, die mit mir und meiner Lebenseinstellung Schwierigkeiten haben. Nichtsdestotrotz: Ich schreibe gerne Briefe, weil sie eine so angenehme und langsame Art der Auseinandersetzung mit dem Empfänger sind. Am Wochenende habe ich „PS: I love you“ angeschaut und war wieder sehr gerührt, wie der schwerkranke Gerry Briefe für seine künftige Witwe verfasst hat, um sie durch die Trauerzeit hindurch in ein neues Leben zu begleiten.
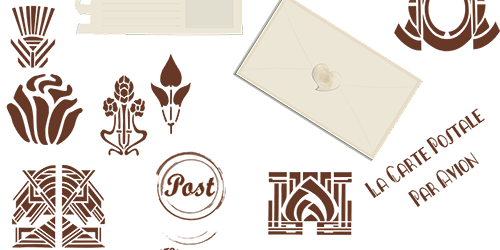
Ich habe so etwas Ähnliches einmal gemacht. Natürlich völlig kopflos verliebt, habe ich einem Mann von einer Reise eine Ansichtskarte geschrieben, in eine eher postalisch unverlässliche Gegend dieser Welt. Und der Absendeort war auch nicht störungssicherer. Zum Zeitpunkt des Schreibens war ich absolut der Meinung, dass diese Liebe (oder was ich damals darunter verstanden habe) mindestens so lange wie der Postweg dauert. Leider habe ich mich geirrt, und mein Liebesgeschwafel hat im Grunde das Zerwürfnis noch beschleunigt. Abgesehen davon wurde diese Ansichtskarte wider Erwarten auch von anderen Menschen entziffert. Unschön, aber glücklicherweise weit weg.
Inzwischen schicke ich kaum mehr Karten und Briefe, wenn ich unterwegs bin. Es gibt schließlich den WhatsApp-Status, wo man die Erlebnisfotos hineinstellen und sie erläutern kann, falls es jemanden interessiert. Die meisten freuen sich über die Bilder, und dabei bleibt es dann auch. Diesen Effekt hatten auch meine Ansichtskarten, weil sie eben nicht leserlich waren. Manches geht tatsächlich mit weniger Aufwand, aber halt auch ohne Sponsoring der örtlichen Postwirtschaft. Und deutlich ohne Hingabe.
Ich finde Briefeschreiben hingebungsvoll. Zum Weihnachtsfest schreibe ich stets welche, und das geht nicht ohne Hingabe. Hingabe an den Menschen, den der Brief erreichen soll. Hingabe an das Gefühl, das ich für diesen Menschen empfinde. Hingabe an die Sprache und den Ausdruck dessen, was ich transportieren möchte. Und was ich verstanden wissen will. Das macht nötig, sich tatsächlich in eine Gesprächssituation zu versetzen, auch wenn das Gegenüber möglicherweise weit, weit weg ist von einem selbst. Und dadurch treten wir auch einen inneren Prozess los. Denn wenn wir beispielsweise keine Idee haben, was wir dem anderen mitteilen wollen, könnte es sein, dass es besser ist, zu schweigen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass jeder Nachricht in den sozialen Netzwerken ein Brief vorausgehen sollte, um das zu überprüfen. Doch manchem und mancher möchte man das tatsächlich empfehlen. Ich erwische mich selbst immer noch dabei, dass ich unachtsam eine Nachricht absondere und dann beglückt bin, wenn mein Gegenüber großzügig genug ist, diese Unachtsamkeit zu tolerieren. Doch zufrieden mit mir selbst bin ich in diesen Augenblicken nicht. Was ich daraus lerne? Zwischen einer Nachricht und der Antwort darauf einfach ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Als wäre es ein Brief, der auch seine Zeit braucht, bis er den Empfänger oder die Empfängerin erreicht. Es gibt nichts, was uns drängt – außer wir selbst. Und das können wir glücklicherweise selbst in die Hand nehmen und ändern.
Weitere Beiträge von Claudia Dabringer finden Sie hier.
Bilder © Pixabay