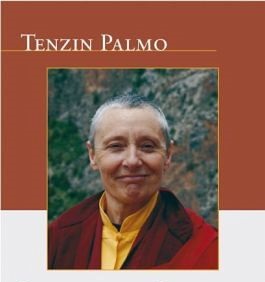Zwei Informationen haben mich kürzlich aufhorchen lassen: Ein Viertel der Jugendlichen kann nach der 9. Schulstufe nicht sinnerfassend lesen. Und Selbstmord ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen. Ein Zusammenhang?
Gerade während der C-Zeit ist der Fokus immer häufiger auf die jüngere Generation gelenkt worden. Zuerst die Schulsituation, dann das heimliche Partying und irgendwann einmal tatsächlich auch das Augenmerk auf ihre psychische Situation während der Monate des Lockdowns. Nicht zu vergessen: das neu beschlossene Impfangebot für die Jungen. Kürzlich fragte mich mein Ältester, ob ich etwas über Selbstmorde von jungen Menschen wisse oder gelesen hätte. Ich verneinte, doch das Universum hat geliefert.
Weltweit zählt Selbstmord zur zweithäufigsten Todesursache bei Kindern und Jugendlichen, in Japan ist er sogar die Nummer eins. In Bayern hat im vergangenen Jahr jeden zweiten Tag ein junger Mensch versucht, sich das Leben zu nehmen. Da steckt eine ganz große Not dahinter, mit diesem Leben zurechtzukommen. Und auch wenn meine Kinder schon dem jugendlichen Alter entwachsen sind, ist meine Zugewandtheit für diese Altersgruppe geblieben. Und das steht meiner Meinung nach unserem Alter gut und notwendig an.
Kinder sind unsere Spiegel – einerseits. Andererseits wachsen sie in einer ganz eigenen Erlebniswelt auf. Und damit meine ich jetzt nicht die Pubertät, deren Reibungspunkte seit Jahrhunderten generell den gleichen Hintergrund haben. Sie bekommen von uns nach bestem Wissen und Gewissen etwas beigebracht, was wir gut finden. Als meine Kinder noch kleiner waren, haben sie mich oft dazu inspiriert, darüber nachzudenken, ob ich eine Erziehungsprägung reproduziere oder etwas wirklich gut und sinnvoll finde oder ihr Wohl mein Motor für Rat und Tat war. Nicht selten musste ich mich dabei erwischen, dass ich reproduziert habe. Dass ich für mich persönlich Wertvolles implementieren wollte. Und das hat dazu geführt, dass ich mir immer öfter überlegen musste: Welche Richtlinien könnten für ihr Leben wichtig werden?

Natürlich kann man das immer nur vom gegenwärtigen Stand des Bewusstseins aus tun. Und meines ist jetzt auch ein anderes als damals. Doch ich bin überzeugt, dass man sich gerade im Umgang mit jungen Menschen regelmäßig auf den Prüfstand stellen sollte. Und zwar insofern, dass man überprüft, ob die eigenen Werte mit der Erlebniswelt der Youngsters kompatibel sind. Sind sie es nämlich wenig bis gar nicht, bringen wir Kinder in eine Situation, die sie zerreißt. Weil ihr Gehirn noch nicht diese Lösungskompetenz entwickelt hat, die wir Erwachsene (vielleicht) haben. Weil sie nicht wissen, wie sie selbstständig drinnen und draußen vereinen können. Und das betrifft sowohl das Wechselspiel zwischen ihrem ganz persönlichen Drinnen und allem anderen sowie jenem zwischen Familie und anderen Gruppenerlebnissen in der Schule, im Freundeskreis. Und dazu noch die riesige Informations- und Social Media Bubble, die dazu beiträgt, dass man selbst als geerdeter Mensch manchmal aus den Schuhen kippt. Ich beispielsweise könnte mich total in die Themen Israel-Palästina, Impfstoffangebot für Afrika, Reisemöglichkeiten und C-Angst fallen lassen. Doch ich tue es nicht, weil ich damit vor allem eines generiere: schlechte Gefühle. Also lenke ich meine Aufmerksamkeit auf Dinge, die ich als angenehm empfinde. Kann auch schwer sein, ist aber erlernbar.
Dazu muss man sagen: Ich kann das auch noch nicht so lange. Und im Alter zwischen zehn und zwanzig hatte ich diesen Ausweg gar nicht. Auch mit dreißig nicht, da ist mir mein Ältester schon voraus. Doch er arbeitet wirklich hart daran, weil auch er immer wieder mit der Realität konfrontiert ist, die eben nach einem einzigen Muster funktionieren soll. Ob dieses Muster für junge Menschen immer noch funktioniert, fragt man sich selten. Schaut man sich die Suizidzahlen an, muss man wohl mit Nein antworten.
Unsere Kinder wurden unter der Bestärkung groß, dass es sich lohnt, einer Arbeit nachzugehen, die ihnen Freude macht. Dafür haben alle ein Studium absolviert oder sind gerade im Begriff, es abzuschließen. Wenn ich nun höre, dass ein Viertel aller Schulabgänger*innen nach der 9. Schulstufe nicht sinnerfassend lesen kann, möchte ich laut fragen, ob es vielleicht damit zusammenhängt, was sie lesen (müssen). Oder dass die Diskussion darüber, wie das Alte mit dem Neuen zusammenhängt, aus Zeitmangel nicht stattfinden kann. Weder in der Schule noch zu Hause. Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein hat gesagt: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Dass junge Menschen die Nachrichten auf ihren Smartphones sehr wohl lesen können, steht außer Zweifel und unterstreicht meine These, dass sie können, wenn sie wollen oder es für sinnvoll erachten. Ich habe schon in meinen jungen Jahren nicht als zielführend für mich empfunden, Goethes „Faust“ zu lesen. Und ich bin jetzt lediglich mit zwei Fernseh- und drei Radiosendern aufgewachsen. Warum sollte man also aus Sicht junger Menschen heute Goethe lesen, wenn vieles einfacher geschrieben ist und vielleicht ebenso wertvoll sein kann für ihre Entwicklung? Ich betrachte es als traditionsverhaftete Sturheit, so zu argumentieren, dass wir und vorhergehende Generationen auch nicht daran gestorben sind. Natürlich stirbt man nicht an schlechter oder unverständlicher Lektüre. Aber eine gute Geschichte kann das Leben bereichern und es spannend machen.
Wenn man in jungen Jahren schon nicht mehr gespannt auf seine Zukunft ist, dann muss etwas geschehen. Und zwar bei den Menschen, die die Jugend begleiten. Die ihnen Perspektiven aufzeigen können, die für sie erstrebenswert erscheint. Bei denen sie andocken und Visionen entwickeln können. Bei denen sie Lust aufs Leben bekommen. Es liegt an uns, den scheinbar Erwachsenen, den Jungen entgegen zu gehen auf diesem Weg, der Leben heißt. Mit Stärke, aber auch mit einem gerüttelt Maß Flexibilität, wenn es um die eigenen Prinzipien und Prägungen geht. Und ihnen vorzuleben, dass es immer eine Lösung gibt, wenn man gemeinsam danach sucht. Das scheint mir eine der vorrangigen Erziehungsziele heutzutage zu sein. Und geduldig im Gespräch zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer fällt.
Weitere Beiträge von Claudia Dabringer finden Sie hier.
Bilder © Pixabay