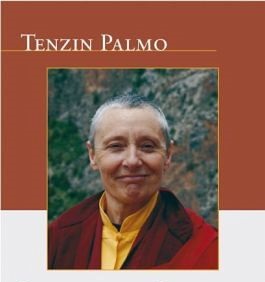Manchmal entdecken Menschen auf ihrer Lebensreise, dass sie sich ihrer Ursprungsfamilie nicht mehr zugehörig fühlen, vielleicht auch nicht mehr den Freundinnen und Freunden und Kollegen einer bestimmten Lebensphase, vielleicht auch nicht mehr einer Stadt oder Sprache.
Bei ihrer Tiefenforschung, wenn sie denn gemacht wird, und auf ihrer weiteren Lebensreise, die einer Visionssuche gleicht, gehen sie sogar so weit zu behaupten, sie hätten sich von ihrem ganzen Wesen her den anderen noch nie zugehörig gefühlt.
Dann ist es Zeit, den eigenen Stamm zu finden. In der von mir gegründeten Frauenschreibschule KALLIOPE war es die Gruppenzugehörigkeit, die dazu führte, sich bewusst aus alten Bindungen, Loyalitäten, für selbstverständlich gehaltenen Zukunftsentwürfen zu lösen und das Bardo des Übergangs auszuhalten. Wir praktizierten symbolische Übergangsrituale und erforschten und erfuhren ihren tiefen Sinn. Wir wurden feinfühlig dafür, ob wir auf der Schwelle standen, mit einem Bein im alten und mit dem anderen Bein schon im neuen Raum, vielleicht hin und her wippend. Noch können wir zurück ... trauern, Abschiede nehmen, Zweifeln, wütend sein, Bilanz ziehen – all dies gehört zu dieser Phase: Wir spüren, wie etwas ruft und wie etwas uns zurückhält. Ein unsäglicher Zustand, den manche von uns gerne abkürzen und übergehen wollen: Da werden übereilte Entscheidungen getroffen, Beziehungen ohne Aussprachen abgebrochen, Porzellan und Türen zer- und zugeschlagen, lange und längste Reisen unternommen.
Was ist los? Das Leben ruft. Etwas will uns in größere Lebendigkeit ziehen, möglicherweise schon seit Jahren, aber wir haben nicht richtig hingehört, wurden krank oder länger unglücklich. Wir haben dem Ruf des Lebens zu folgen, wenn wir tiefen Sinn und Zugehörigkeit erleben wollen. Unseren Platz im Leben suchen wir und sind erst beruhigt, wenn wir ihn gefunden haben. Künstlern und Lebenskünstlern aller Art ist eine solche Suche vertraut. Ebenso geht es Suchenden, Gottsuchenden. In anderen Künstlerinnen, Pilgerseelen entdeckten sie sich selber.

Doch man täusche sich nicht. Künstler mögen herausfinden, dass ihre Kunst tatsächlich das Beste ist, das sie einer Gemeinschaft zu geben haben. Man meint dann leicht, das müsse allen so gehen. Nein, ich lernte Menschen kennen, denen ihre anscheinend langweilige Tätigkeit im Büro viel Freiheit schenkte. Und da diese Arbeiten neben vielen anderen, die scheinbar nichts Selbstverwirklichendes an sich haben, oft notwendig für eine Gesellschaft sind, erfahren sie sich ebenfalls als nützlich, als gebend, als dienend.
Wir alle sind auf den „Dienst“, auf die Arbeit anderer angewiesen, daran ändern auch sogenannte autarke Lebensmodelle nichts. Und das ist gut so. Wir lernen die Vielfalt menschlicher Ausdrucksmöglichkeiten schätzen und diese Wertschätzung auch auszudrücken. Während wir das tun, bezeugen wir unsere Zugehörigkeit zur Menschenfamilie, die uns schützen hilft vor Abgrenzung, Spaltung, Überheblichkeit, Konkurrenzdenken. Doch immer wieder wird es Bardos geben, während wir reifen und weitergehen.
Vielleicht verhält es sich ja so, dass wir ein Zuhause im Bardo finden, wo wir unser komplettes Menschsein empfinden und ausdrücken können.
Weitere Beiträge von Monika Winkelmann finden Sie hier.