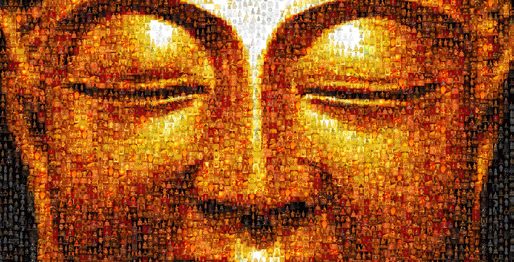Diese Frage beschäftigt mich – neben anderen Fragen, wie zum Beispiel Bequemlichkeit, Ärger, Schatten, Liebe, edles und unedles Schweigen … – immer wieder. Versuchen nicht alle buddhistischen Bücher und Artikel eine Antwort darauf zu geben? Und suchen wir nicht immer wieder selber diese Antwort, diese tiefe innere Resonanz zu einer Praxis, die alles andere als leicht ist?
Bis ich meinem Zen-Lehrer Genjo Marinello begegnete, hatte ich merkwürdige Vorstellungen von Meditation. Mir war zwar nicht mehr fremd, dass man sich auf eine Matte und Kissen setzte, möglichst regelmäßig, immer mal wieder für länger, wenn möglich, und nach innen schaute. Ich konnte auch verschiedentliche heilsame Entwicklungen bei mir beobachten. So hatte sich bei mir über die Zeit eine andere, bewusstere Art des Sitzens eingestellt, eine bewusstere Art des Gehens, vor allem, wenn es mir nicht gut ging und ich Zwangsgedanken verfolgte. Ich konnte in schwierigen Situationen ‚sitzen‘, statt zu grübeln (aufrecht im Bett oder in der Straßenbahn oder wo auch immer) und mir fiel das geliebte Mantra meines ebenso geliebten Lehrers und Dichters Thich Nhat Hanh ein: Ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Ein Schritt „Ich bin angekommen“, ein zweiter „ich bin zu Hause“. Das kann man auch so elegant machen, in der Stadt zum Beispiel, dass einem niemand ansieht, dass man gerade Gehmeditation übt.
Dennoch hatte ich jede Menge Vorstellungen darüber, wie ich, die anderen, die weltlichen Umstände zu sein hätten, damit es mir besser ging, und wie auch das Meditieren zu sein hätte, damit es mir besser ging! Besser, das heißt, damit ich ausgeglichener, gesünder, liebevoller, friedvoller, geduldiger wäre und meinem Altern und Tod unerschrockener begegnen könnte.
Ich war nicht darauf vorbereitet – oder war ich es doch, insgeheim, und musste nur noch den Mut und den Lehrer finden, um mich auf den Weg zu machen? –, mir selber und meinem ‚mind‘ in der Weise zu begegnen, wie es dann 2013 in meinem ersten Zen-Retreat mit Genjo Osho in Birmingham geschah. Es war ein kurzes Wochenend-Sesshin von Freitag bis Sonntag. Ich werde es mein Lebtag nicht vergessen. Wir waren ungefähr zwanzig TeilnehmerInnen und lebten praktisch die ganzen Stunden in einer geräumigen Aikido-Halle. Es gab eine Dusche und eine Toilette, und alle schliefen in der Halle. Es war Mai und ein sehr kalter Frühling, die Fenster waren immer leicht geöffnet. Carolyn Stevens, die Frau von Genjo Marinello, bereitete die Mahlzeiten vor als ‚Tenzo‘, wie es im Zen heißt.
Wir aßen auch an langen Tischen im ‚Zendo‘, rezitierten und schwiegen.
Ich habe fast die ganze Zeit geweint. Vor Bewegtheit. Manchmal auch vor Schmerzen. Aber meistens, weil ich so tief angerührt war. Jedes Wort, das der Lehrer sprach, jeder Text, den wir rezitierten, jede Sitzperiode, so unvollkommen, so zappelig und ungesammelt ich mich auch wahrnahm, scheint mir im Rückblick wie eine Epiphanie gewesen zu sein. Ich war irgendwie angekommen bei etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es gesucht hatte. Ich fand nichts von dem, was ich oben beschrieben habe: Gelassenheit und dergleichen, aber ich fand etwas total Unerwartetes und Unbeschreibbares. Einen Geruch von Nicht-Wissen, unbeschränkter Weite, unendlicher Tiefe und ebenso unendlicher Verbundenheit.
Meine ersten ‚Dokusans‘, die privaten Interviews mit dem Lehrer, fand ich begeisternd: Später, als mein Kopf dazwischenkam, wurde alles wieder schwierig. Ich fand einen Geist in mir, der sich quälte, andere quälte, seine Sorgen kaum abstellen konnte, nach Kontakt mit den anderen gierte, Angst hatte, wie es mit mir weitergehen würde, der kaum im Moment anwesend sein konnte bei dem, was war.
Ich hörte alle Glocken der ganzen Welt auf einmal klingen. Und weinte und weinte.
Seitdem war ich siebenmal in Seattle auf sieben- oder achttägigen Sesshins. Konnte Genjo viermal nach Deutschland einladen. Ich bin tatsächlich gelassener geworden: Mit meinen Schwächen und denen meiner Mitmenschen. Ich bin mehr mit dem, was real ist, und nicht mit dem, was und wie ich es gerne hätte. Meine Freunde nehmen mich als etwas großzügiger wahr. Ich fühle mich von diesem tragenden Urgrund – oder wie wollen wir ES nennen – geliebt. Eins. Ungetrennt. Immer öfter. Ich nehme meine großen Ängste und andere Emotionen wesentlich stärker wahr als vorher. Dieser Blick in den Spiegel tut sehr weh und ist sehr notwendig. Wir brauchen ja nur auf den Zustand der Welt zu schauen, um zu sehen, dass etwas zutiefst nicht in Ordnung ist mit uns Menschen. Oder ist es einfach nur, wie es ist? Und ich bin dazu da, Zeugnis abzulegen von der Freude und dem Leiden überall und der Einheit allen Lebens?
Mit meinem täglichen Leben versuche ich, auf dieses Koan zu antworten. Ein Mensch zu werden.