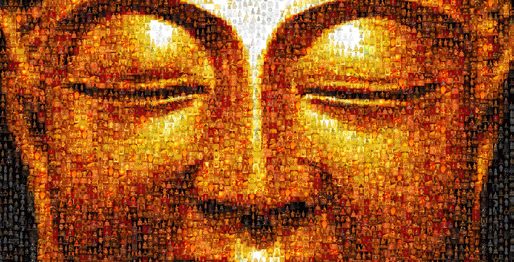Seit einigen Tagen meditiere ich 20 Minuten pro Tag nach den Anweisungen von Deepak Chopra. Dabei geht es um Wünsche, woher sie kommen und wie sie sich erfüllen. Es ist zwar schwierig, diese Zeit im Tag unterzubringen, doch ich nehme sie mir.
Weil ich das Gefühl habe, dass ich muss. Weil meine 36-Stunden-Tage langsam mein Energie-Reservoir erschöpfen. Weil ich EINEN Fixpunkt am Tag brauche, der nur mir gehört. Auch wenn ich dabei irgendwelche schwierigen, für mich völlig unverständlichen Silben still vor mich hinbrabble und nur hoffen kann, dass eine etwaige falsche Aussprache nicht meine Wünsche sabotiert. Man weiß ja nie, was sich der Erfüllung derselben in den Weg wirft.
Ja, ich arbeite mich offensichtlich immer noch am Wünschen ab. Und ich lerne, dass man sich selbst dabei nicht überfordern sollte. Und unterscheiden muss zwischen dem Wunsch nach einem Jaguar in der Garage und dem nach Frieden in der Seele. Nicht, dass ich viele materielle Wünsche hätte. Es geht mir wirklich gut, und der Traum vom Domizil mit Meerblick wird sich dann erfüllen, wenn ich den richtigen Platz gefunden habe. Dabei unterstützen mich Helfer und Helfershelfer, doch es muss einfach „Klick!“ machen - ist wie bei einem Mann. Doch das ist eine andere Geschichte.
Ich werde in der Meditation also angehalten, mir drei Dinge zu wünschen. Nein, der Weltfrieden ist nicht darunter, obwohl das natürlich etwas ganz wichtiges ist. Doch da ich der Meinung bin, dass der Weltfrieden bei uns selbst anfängt, sollte ich die Frage nicht vorschnell verneinen. Also ja, irgendwie geht es auch um den Weltfrieden. Der in meinem Kopf beginnen sollte. Doch jeder, der meditiert, kennt die aufpoppenden Gedanken, die wie Luftblasen im Hirn herumkurven. Was man alles vergessen hat. Was man noch tun sollte. Wie man das und jenes am besten anpacken könnte. Da immer wieder zum eigentlich unaussprechlichen Mantra zurückzukehren, ist eine stete Herausforderung.
Meine Blasen drehen sich weniger um das kleine Scheitern oder die große To-Do-Liste des Tages. Die werde ich wahrscheinlich im Jahr 2030 abgearbeitet haben – insofern habe ich keine Eile. In meinem Kopf poppen die Menschen auf, die Teil meines Lebens sind und mich daran teilhaben lassen. Eine Frau, die jüngst nach der Babypause wieder in ihren Job zurück gekehrt ist und befürchtet, nicht zu genügen. Ein Mann, der nach einer Konfrontation mit seiner Vergangenheit so zerstört war, dass er nicht mehr Auto fahren konnte. Eine andere Frau, die so von Schmerz erfüllt ist, dass sie beinahe gelähmt ist. Und ein anderer Mann, der keinen anderen Weg sieht, aus den selbstgewählten Zwängen und Verpflichtungen auszubrechen, als krank zu werden.
Jedem einzelnen dieser Menschen möchte ich beistehen, möchte tragen und helfen. Beim einen geht es einfacher, bei der anderen schwerer. Und doch werde ich durch die Meditation gezwungen, alles – zumindest für 20 Minuten – loszulassen. Ich fühle mich schlecht dabei. Andererseits weiß ich auch, dass ich in energielosem Zustand niemandem nützen kann. Zumindest nicht auf Dauer. Denn irgendwann schwebe ich dann vielleicht durch die Meditationsblasen eines anderen Menschen, weil ich komplett ausgebrannt bin.
Das gilt es zu vermeiden, weshalb ich am Ende dieser 20 Minuten friedlich mit mir bin und weiß, dass ich nicht nur für mich selbst Ruhe gegeben, sondern daraus auch mein Reservoir für andere aufgefüllt habe. Und die Wünsche? Einerseits lerne ich, dass alle Möglichkeiten in mir liegen. Klingt schon einmal gut. Und dass ich sie ausschöpfen kann, wenn ich nur aus den richtigen Gründen wünsche. Auch das hatte ich schon mal. Doch ich verstehe auch, dass ich nicht nur für mich selbst einen inneren Wunschzettel brauche, sondern auch einen Nutzen für das Gegenüber rekrutieren sollte.
Nehmen wir an, ich würde mir ein Pony wünschen. Dann wäre die Herausforderung dabei, einen Nutzen für das Pony zu finden. Denn das würde die Erfüllung dieses Wunsches wahrscheinlicher machen. Ob es reicht, dass ich ihm einen Garten zum Grasen und viel Zuwendung schenken könnte, aber leider weder reiten noch Auslauf zur Verfügung stellen kann, weiß ich nicht. Deshalb wünsche ich mir auch kein Pony.
Die Erlaubnis des „Meisters“, über meine Wünsche zu sprechen, habe ich noch nicht. Deshalb behalte ich sie vorerst für mich. Was ich allerdings sagen kann: Es ist gar nicht so einfach, etwas zu finden, was nicht allein aus egoistischen Gründen Wirklichkeit werden soll. Denn es erfordert sehr viel Selbstkritik, diese Intentionen zu hinterfragen. Nicht immer angenehm, aber ungemein lehrreich. Wenn ich die richtigen Wünsche formuliert habe, werden sie in Erfüllung gehen. Und dann hält mich nichts mehr davon ab, darüber zu schreiben. Ich halte Sie auf dem Laufenden! Versprochen.