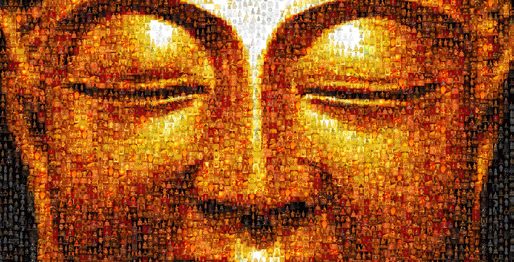Was der Künstler Michael Vetter als ‚transverbale Rituale' bezeichnet, sind Spiele, in denen der Zen-Geist lebendig wird wie das Zen-Steine-Meditations-Spiel.
Meistens werden Spiele zur Zerstreuung verwendet. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum manche Buddhisten und Zen-Übende mit Spiel wenig anfangen können. Doch das japanische Zen, vor allem aber das chinesische Ch'an kannte durchaus lustige und schräge Meister, die witzig und spielerisch waren. Etwas von diesem Geist täte auch uns gut. Einer, der hier als Pionier gewirkt hat, ist der Künstler Michael Vetter. Nach 12 Jahren in Japan, wo er sich dem Zen-Weg widmete, kehrte er 1983 in den Westen zurück. Er lebt auf einem Hügel im Schwarzwald, dem er den poetischen Namen ‚Schauinsland' gegeben und auf dem er einen Zen-Garten angelegt hat. Über die Jahre entstanden dort viele Spiele, die sogenannten ‚Transverbalen Rituale', die sich durch größte Einfachheit auszeichnen, was sich bereits in den Titeln ausdrückt: ‚Stehen', ‚Gehen', ‚Der Balance-Akt', ‚Schreibspiele' oder auch ‚Das Stein-Spiel'.
Der Ablauf des Stein-Spiels wird von Michael Vetter in Verszeilen beschrieben:
„Ein paar Steine, möglichst nicht zu klein / liegen in der Mitte des Kreises, / angeordnet in der Konzentration eines Zen-Gartens. / Wir sitzen drum herum in stiller Betrachtung. / Von Zeit zu Zeit steht jemand auf, / begibt sich in den Kreis / und verändert die Position eines der Steine. / Wobei es nicht allein um vollendete Tatsachen geht, / sondern um den Prozess der Veränderung, / ja noch unmittelbarer: um den Prozess des Veränderns, / beginnend mit dem Aufstehen / und endend / mit dem Sich-wieder-Setzen der eingreifenden Person. / Sitzt der Akteur schließlich wieder auf seinem Platz, / so hat sich für jeden der Steine / die Konstellation entscheidend verändert, / und aus jedem Blickwinkel ist diese Veränderung / auf andere Weise bedeutsam." (Vetter, S. 177)
Für das Zen-Steine-Spiel brauchen wir ein Spielfeld, eine Spielregel und natürlich Steine.

Das Spielfeld:
Größe und Form des Spielfeldes spielen keine Rolle, genauso wie ein Zen-Garten der Innenhof einer Klosteranlage sein kann, aber auch die mit Sand gefüllte Schale neben dem Schreibtisch. Vetter schreibt zwar von einem runden Spielfeld, es kann jedoch auch quadratisch sein. Für eine Gruppe um die zehn Personen ist erfahrungsgemäß die Größe einer Sandkiste, wie wir sie aus Kindertagen kennen, empfehlenswert. Tatsächlich habe ich einmal mit etwa zwölf Studentinnen und Studenten das Zen-Steine-Spiel in einer Sandkiste gespielt. Einige waren so in das Spiel vertieft, dass erst die Dunkelheit der Nacht ein Ende erzwungen hat.
Von größter Wichtigkeit ist die genaue Grenze. Es ist ein zentrales Merkmal japanischer Ästhetik, eine genaue Grenze zwischen dem Bereich der Natur und dem Bereich geistiger Klarheit zu ziehen. Diese Grenze wird ‚der Schnitt' genannt. Es ist der Schnitt, mit dem sich der Mensch vom Naturwesen trennt und damit seine geistige Autonomie erhält, ohne sich jedoch von der Natur abzuschneiden. Das ist der besondere Dreh des Zen-Bewusstseins: ganz in der Welt zu sein, aber nicht in ihr aufzugehen, sondern durch einen Schnitt den Geist aus seiner Verstrickung zu befreien. Wir finden dies exemplarisch in den Zen-Tusche-Zeichnungen: Die Natur wird in ihrem überwältigenden Formenreichtum dargestellt, das Refugium des Menschen ist davon genau abgegrenzt und von geraden Linien und Schlichtheit geprägt.
Doch kehren wir zum Spiel zurück.
Innerhalb der Grenzen sollte das Spielfeld leer sein. Es sollte eine ‚Stätte des Leerseins' darstellen. Diese Leere schafft die Konzentration, die wir ungeteilt und beständig auf die Steine richten können.
Die Steine, 9 bis 12 an der Zahl, sollten rund und so groß sein, dass sie gut in der Hand liegen, aber vor allem sollten sie möglichst gleich aussehen. Diese möglichste Gleichheit ist wichtig. Wer auch nur ein wenig Erfahrung mit Meditation besitzt, wird die erstaunliche Erkenntnis gemacht haben: Je ruhiger der Geist wird, das heißt, je weniger verschiedene Dinge und Gedanken er registrieren und verarbeiten muss, desto feinere Unterschiede nimmt er wahr. Die Steine können sich noch so gleichen, nach einiger Zeit werden wir sie unterscheiden, ob wir wollen oder nicht.
Die Steine sollten auch rund sein, damit sie nicht zum Bauen einladen. Jeder eckige Stein wird fast unvermeidlich zum Turmbau verwendet – und gerade darum geht es nicht. Die Steine dienen nicht dem Zweck, als Bausteine für ein größeres Gebilde zu fungieren, sondern sie sind wandernde Felsen und Berge im leeren Raum.
Die Spielregel lässt sich in zwei Sätzen formulieren: Jede und jeder darf jederzeit einen – und nur einen – Stein an einen anderen Ort legen. Anschließend sollte eine Weile der Betrachtung folgen, bevor neuerlich ein Stein versetzt wird.
So einfach ist das Zen-Steine-Meditations-Spiel!
Ein leeres Spielfeld, einige Steine und eine einfache Regel. Und doch vollzieht sich im Spiel der unendliche Reichtum des Bewusstseins. Das leere Spielfeld, in dem die Felsen wandern und immer neue Konstellationen bilden, ist Spiegel unseres ruhigen und leeren Geistes. Der stille, leere Geist ist der Möglichkeitsraum, in dem nichts sein muss, aber alles sein kann, das Ich und alle Anhaftungen an die Welt dürfen verschwinden, aber erstaunlicherweise ist das Ergebnis kein Verlust, sondern ein Gewinn: die Wahrnehmung der Welt, wie sie ist, einschließlich der unendlichen Möglichkeiten, die sie bietet. Die Welt wird gleichsam durchscheinend, und durch die Dinge, wie sie sind, scheint etwas davon auf, dass alles, so wie es ist, wundervoll ist, aber dass alles auch ganz anders sein könnte. Berge sind Berge und stehen fest gegründet. Das ist unsere Alltagserfahrung, mit der wir gut und erfolgreich leben und die wir auch nicht aufgeben wollen. Der leere Zen-Geist jedoch lässt die Berge frei. Sie dürfen auch wandern, wenn sie wollen und sich dafür entscheiden. Vielleicht sind sie wirklich weit gewandert und stehen nun zu Gebirgen zusammen. Sofort beginnt unser Verstand wieder zu arbeiten, er vergibt Namen, sucht eine Ordnung, Gebirgszüge werden unterschieden und mit eigenen Bezeichnungen versehen.
Diese Selbsttätigkeit des Geistes erfahren wir im Steine-Spiel.
Die Steine wandern im leeren Raum des Spielfelds. Sie sind nichts anderes als Steine im Raum. Der Teil des Geistes, den wir Verstand nennen, beginnt zu arbeiten. Er bezeichnet den Stein, den ich gerade versetzt habe, als ‚meinen Stein'. Die ganze Dramatik zwischen ‚mein' und ‚dein' entsteht. Weiters: Die Art und Weise, wie die Steine liegen, setzt Assoziationen frei. Bilder werden produziert und auf die Konstellation der Steine projiziert. Das Zen-Steine-Spiel ist eine schöne Gelegenheit, die Tätigkeit des Geistes zu beobachten und in einem weiteren Schritt zur Ruhe zu bringen, leer zu machen. Wenn der Geist so leer ist wie das Spielfeld, dann dürfen die Steine Steine sein – und sie dürfen wandern. Sie dürfen aus den unendlich vielen möglichen Konstellationen einige wenige verwirklichen. Damit ist das Spiel ein Spiegel meines Lebens. Ich bin radikal frei, alles innerhalb des Spielfeldes, das mein Leben ist, zu verwirklichen. Der leere Zen-Geist weiß, dass keine übergeordnete Bedeutung existiert. Die Verwirklichung geschieht immer nur in der momentanen Konstellation. Aber das Leben muss auch mit demselben heiligen Ernst betrieben werden wie das Steine-Spiel. Die Steine, genau wie mein Leben, müssen in beständiger gesammelter Achtsamkeit in Bewegung gehalten werden. Es gibt keine fixe, unbewegte letztgültige Position. Es gibt kein Leben ohne Bewegung, ohne die Bewegung des Atems. Gleichzeitig ist die Bewegung nicht wichtig, nicht wichtiger als ein Spiel, aber es ist eben auch so wichtig wie ein Spiel, wie ein Steine-Spiel mit seinen unendlichen Möglichkeiten. Das können wir im Spiegel des Zen-Steine-Meditations-Spiels erfahren – nicht mehr, aber auch nicht weniger.