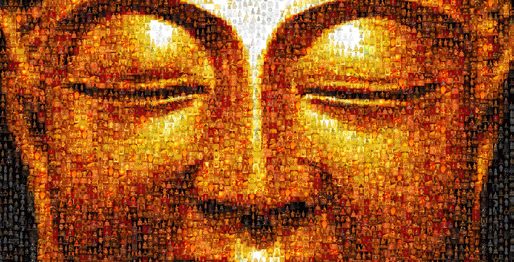Gedanken lassen sich in bildgebenden Verfahren messen – wer meditiert, synchronisiert die Gamma-Wellen im Kopf, das erzeugt Glücksgefühle. Auszug aus einem Buch zum Thema.
Man muss lange laufen, um das Glück zu finden, es liegt fünf Tagesmärsche von der nächsten Straße entfernt: Das Tsum-Tal in Nepal, zwischen den Achttausendern Manaslu und Shishapangma, gut 200 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Kathmandu entfernt. Eine grüne Hochebene mit Gersten- und Hirsefeldern, grasenden Yaks, Gebetsfahnen, die im Wind flattern, Häusern aus Stein, Holz und Lehm, eingerahmt von schneebedeckten Bergen und Gletschern – so beschreibt der Reporter Titus Arnu die Gegend in seinem Buch Tsum.
Tsum bedeutet ‚Strom des Glücklichseins‘. Es ist freilich ein anderes Glück als jenes, das die meisten Menschen in westlichen Ländern suchen. Das subjektive, irdische Glück spielt hier keine Rolle. Im Buddhismus geht es vielmehr darum, Gutes zu tun und Leiden zu beenden. Am Ende soll der Mensch genug positives Karma gesammelt haben, um den Kreislauf der Wiedergeburten zu beenden. Das Tsum-Tal ist seit Jahrhunderten ein beliebter Rückzugsort für buddhistische Mönche und Nonnen. Im Jahr 1920 verpflichteten sich die Bewohner, gewaltlos zu leben, seitdem jagen und fischen sie keine Tiere, sie ernähren sich fast komplett vegetarisch.
Sind die Menschen im Tsum-Tal glücklich? Nach offiziellen Angaben dürften sie es nicht sein, denn im World Happiness Report steht Nepal nur auf Platz 99. Den Bericht haben Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler erstellt und er beruht auf Daten wie Durchschnittseinkommen, Lebenserwartung, Bildung und Zugang zu medizinischer Versorgung. Mit einem Jahreseinkommen von weniger als 700 Dollar pro Kopf gehört Nepal zu den ärmsten Ländern der Welt. Und im Tsum-Tal sind die Menschen noch ärmer, sie betreiben keinen Handel, der Bildungsstand ist niedrig und die Kindersterblichkeit hoch, schreibt Titus Arnu.
Trotzdem bezeichnen sich die meisten Menschen als glücklich. Glück sei für ihn eine Kombination von körperlicher Auslastung und geistiger Ausgeglichenheit, sagt ein Bewohner. Man könnte es auch Askese nennen, eine Möglichkeit, Glück zu erlangen. Für die meisten Menschen der westlichen Konsumgesellschaften ist Askese keine Option, auch wenn wir intuitiv wissen, dass materieller Wohlstand nicht notwendigerweise ein erfülltes Leben garantiert.
Für die Bewohner des Tsum-Tals besteht das Glück in einem einfachen Leben, das durch die Normen ihrer Gruppe vorgegeben ist. Sie stellen diese Regeln nicht infrage. Wohlbefinden hängt deshalb auch immer bis zu einem gewissen Grad davon ab, wie gut man mit den Normen zurechtkommt, die die Gesellschaft vorgibt. Es gibt Länder, in denen bestimmte Dinge verboten sind, wie etwa homosexuelle Beziehungen in vielen muslimischen Staaten. Wer trotzdem als Mann schwul ist und heimlich einen Partner hat, wird sich schwerer tun, dauerhaft glücklich zu sein, als der offen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebende Mann in Kalifornien. Denn er muss Repressionen und Strafen fürchten – das macht ein zufriedenes Leben schwierig.
Ziele setzen
Daneben ist entscheidend, welche Ziele wir uns selbst setzen. Glück und Zufriedenheit hängen wesentlich davon ab, wie groß der Abstand zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist. Wer sich vorgenommen hat, mit 20 Jahren eine Partnerin fürs Leben gefunden zu haben, wird womöglich unglücklich sein, wenn die Traumfrau dann noch nicht aufgetaucht ist. Oder er wird seine Ansprüche der Wirklichkeit anpassen und sich sagen, gut, dann treffe ich sie eben mit 25. Das heißt: Wir können daran arbeiten, unser Wohlbefinden zu steigern. Glück und Zufriedenheit sind erlernbar.Ein paar Dutzend Schulen in Deutschland bieten das Fach Glück an. Die Jugendlichen sollen es lernen wie Mathe, Englisch oder Erdkunde. Ein privates Psychologie-Institut hat das Konzept entwickelt und es beruht auf den Prinzipien der Positiven Psychologie. Ob und was der Unterricht bewirkt, ist schwer festzustellen. Denn beim Wohlbefinden spielen neben dem Glückstraining eine Menge anderer Faktoren mit, und in diesem Alter kann sich auch die Persönlichkeit noch recht stark verändern. Der Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Bern, Alexander Bertrams, hat über hundert Schüler an zwei Berufsschulen, in denen das Fach angeboten wird, befragt. Die Hälfte hatte das regelmäßige Glückstraining belegt, die andere Hälfte nicht. Bertrams erstellte auch Persönlichkeitsprofile am Anfang und Ende des Schuljahrs und fragte die Jugendlichen regelmäßig nach ihren positiven und negativen Gefühlen. Sein Fazit: Die Teilnahme wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Schüler aus, allerdings profitieren vor allem jene, die von Beginn an emotional stabiler waren.

Zufriedenheit trainieren
Glückstraining oder -unterricht ist aber nicht nur für Jugendliche sinnvoll, sondern auch für Erwachsene. Auch wenn das positive Lebensgefühl zu einem Teil von den Genen abhängt, ein erhebliches Maß der erlebten Zufriedenheit müssen wir uns selbst erarbeiten. Glück hängt ganz wesentlich von einigen psychologischen Faktoren ab, die sich ihrerseits auch im Gehirn als Aktivitätsmuster von Nervenzellen bemerkbar machen : erstens der Resilienz, also der Eigenschaft, sich von belastenden Erlebnissen zu erholen; zweitens der Grundeinstellung, das heißt, ob wir positive Emotionen lange halten können oder negativ eingestellt sind und immer schon das Schlimmste befürchten; drittens brauchen wir zum Glücklichsein soziale Intuition, also die Fähigkeit, die sozialen Signale der Mitmenschen zu empfangen und ihre Emotionen zu interpretieren. Und ohne Selbstwahrnehmung, den vierten Faktor, können wir auch nur schwerlich Zufriedenheit erreichen, weil wir nicht wissen, was wir empfinden und warum wir so fühlen. Als fünfter und sechster Faktor kommen noch die Kontextsensibilität und die Aufmerksamkeit hinzu. Ersteres ist die Fähigkeit, sein Verhalten an die jeweilige Situation anzupassen, und die Aufmerksamkeit brauchen wir, um uns auf Aufgaben und Situation zu konzentrieren. Diese sechs Faktoren kann man trainieren. So sind beispielsweise soziale Intuition und Selbstwahrnehmung auch wichtige Bestandteile des Schulfachs Glück. Die Jugendlichen lernen, über sich nachzudenken und zu erkennen, was ihnen guttut und was sie im Leben erreichen wollen. Und sie verbessern ihren sozialen Sinn, indem sie einen respektvollen Umgang mit ihren Mitschülern trainieren. Im Tsum-Tal haben sich die Menschen strenge Regeln auferlegt, nämlich keiner Kreatur Schaden zuzufügen. Respekt vor der Schöpfung und Mitgefühl für alle Lebewesen ist in der buddhistischen Religion stark verankert. Selbst gegenüber den kleinsten krabbelnden Insekten zeigen insbesondere Mönche Respekt: Sie können zwar nicht verhindern, dass sie ein paar Würmer und Spinnen zertreten, während sie laufen. Aber sie spucken auf ihre Schuhsohlen und sprechen ein Gebet, bevor sie das Haus verlassen. Buddhistische Mönche sind deshalb perfekte Versuchspersonen, um herauszufinden, wie man Mitgefühl trainiert und was dabei im Gehirn passiert. Der US-Psychologe Richard Davidson hat Experimente mit Mönchen aus Tibet gemacht und schildert sie in seinem Buch ‚Warum wir fühlen, wie wir fühlen‘. Es ist faszinierend, wie Richard Davidson in den 1970erJahren die Meditation entdeckt und untersucht hat, wie sich die Geistesübungen im Gehirn auswirken. Er war überzeugt davon, dass das Trainieren von Gedanken Spuren hinterlässt. Nur war das schwer zu beweisen, denn es gab damals noch keine bildgebenden Verfahren, mit denen sich Veränderungen im Gehirn sichtbar machen ließen. Zunächst wurde er von seinen Kollegen belächelt. Viele Naturwissenschaftler hielten Meditation für Hokuspokus. Seine erste Untersuchung, eine Befragung von Menschen über ihr Meditationsverhalten und ihr Wohlbefinden, erschien im ‚Journal of Abnormal Psychology‘. Doch Davidson ließ nicht locker. 1992 kontaktierte er den Dalai Lama, von dem er wusste, dass er ein Faible für Naturwissenschaften und Technik hat. Mit dessen Hilfe konnte der Psychologe meditationserfahrene buddhistische Mönche finden und untersuchen.
Die Wirkung von Meditation
Im Buddhismus gibt es den Zustand des ‚bedingungslosen Mitgefühls‘, in dem man uneingeschränkt bereit ist, sich für andere Lebewesen einzusetzen. Man kann sich in diesen Zustand durch eine spezielle Meditation versetzen. Die Buddhisten sind davon überzeugt, dass man damit die Empathie verstärkt und dadurch anderen bereitwilliger hilft und sogar den starken Wunsch verspürt zu helfen. Diese Meditation ließ Davidson sowohl Mönche machen als auch – als Kontrollgruppe – Studenten seiner Universität. Diese hatten vorher einen Crashkurs in Mitgefühlstraining bekommen. Danach maßen die Forscher von allen Versuchspersonen die Gehirnströme, sie machten also ein EEG. In den EEG-Daten der Mönche fand sich eine auffallend starke Gamma-Aktivität. Gammawellen sind Gehirnströme mit einer hohen Frequenz, sie deuten also darauf hin, dass viele Nervenzellen ihre elektrischen Signale synchronisieren, das heißt gewissermaßen im Gleichtakt Aktionspotenziale feuern. Gammawellen entstehen immer bei kognitiven Höchstleistungen – wenn wir bei vollem Bewusstsein sind oder besonders anspruchsvolle Aufgaben lösen, die mehrere Gehirnbereiche beanspruchen. Auch bei den Studenten der Kontrollgruppe war die Gamma-Aktivität höher als normal, aber bei Weitem nicht so ausgeprägt wie bei den meditationserfahrenen Mönchen.
Aktiviertes Gehirn
Ein EEG registriert Gehirnströme an der Schädeldecke und ist damit nur ein grobes Maß für Gehirnaktivität. Um genauer zu wissen, welche Bereiche aktiv sind, wenn das Gehirn Mitgefühl empfindet, braucht man die Methode der funktionellen Kernspintomografie oder Magnetresonanztomografie (fMRT). Diese funktionellen Kernspinuntersuchungen machen sichtbar, wo gerade im Gehirn besonders viel sauerstoffreiches Blut fließt, das heißt, wo die Nervenzellen besonders aktiv sind. Diese Messungen sind alles andere als einfach. Die Probanden liegen in einer Röhre. Die Technik benötigt starke Magnetfelder, die man mit Strom erzeugt. Magnetfelder und Stromspulen beeinflussen sich aber gegenseitig, dabei entsteht ein lautes Brummen. In der fMRT-Röhre herrschen also nicht gerade ideale Bedingungen, um zu meditieren.
Außerdem ist das Ergebnis der Messung keine absolute Größe, sondern immer nur der Unterschied zwischen der aktuellen Aktivität des Gehirns und dem Ruhezustand. Den muss man also zuerst einmal messen und dabei aufpassen, dass die Person in der Röhre auch wirklich an nichts denkt und nichts tut, was mit ihrer eigentlichen späteren Aufgabe zusammenhängt. Wenn man dann am Ende nach etlichen Berechnungen im Computer die Gehirnbilder vor sich sieht, dann sind darauf Regionen hervorgehoben, wo Nervenzellen besonders viel Sauerstoff verbrauchen, die also elektrisch besonders aktiv sind.
Die Versuchspersonen in der Kernspinröhre bekamen emotionale Geräusche vorgespielt: angenehme wie das Glucksen eines Babys und unangenehme wie das panische Schreien einer Frau. Vor allem die Schreie aktivierten Gehirnregionen, insbesondere den sogenannten Inselkortex, eine Gehirnstruktur, die an der Verarbeitung von Gefühlen beteiligt ist. Auch der temporoparietale Übergang, ein Bereich zwischen dem Scheitellappen und dem seitlichen Lappen des Gehirns, war aktiv. Die Kernspinbilder zeigten denselben Effekt wie die EEGMessungen: Insgesamt waren die Nervenzellen der Mönche sehr viel aktiver als die der Studenten.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 104: „Wie Gelassenheit geht"
Davidson hat weitere Versuche mit Mitgefühlmeditation gemacht und dabei herausgefunden, dass sich auch das persönliche Leidensgefühl verringert, wenn man dies praktiziert. Man nimmt seine eigenen Schmerzen nicht mehr so wichtig, und das schlägt sich in einer geringeren Aktivität der Amygdala nieder. Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, ist vor allem daran beteiligt, negative Gefühle zu verarbeiten. Je weniger wir davon haben, umso weniger aktiv ist sie. Wir können also durch Training unsere Amygdala gewissermaßen herunterfahren.
Außerdem stellt sich bei Menschen, die regelmäßig die Mitgefühlmeditation praktizieren, eine stärkere Vernetzung von drei Gehirnbereichen ein: erstens dem präfrontalen Kortex, der vor allem daran beteiligt ist, Handlungen zu planen, zweitens dem Inselkortex und drittens dem Nucleus accumbens. Wie gezeigt, stellt dieser Kern von Nervenzellen besonders viel Dopamin her und spielt eine wichtige Rolle, wenn wir eine Belohnung erwarten oder motiviert sind. Man könnte auch sagen: Menschen, die geschult sind, Mitgefühl zu empfinden, sind auch motiviert, anderen zu helfen. Statt angesichts von Leid in Trauer zu versinken, handeln sie lieber, damit es anderen besser geht. Jeder kann sein Mitgefühl trainieren, am besten indem man sich Menschen vorstellt, die in einer schwierigen Lage sind oder sogar leiden. Allein diese Visualisierung versetzt unser Gehirn in einen Zustand des Mitgefühls.
Jeanne Rubner, geboren 1961, ist promovierte Biochemikerin, Journalistin sowie Autorin und ist seit 2012 Redaktionsleiterin beim Bayrischen Rundfunk.